Psychologie der Wahrnehmung
1 Die Subjekt-Objekt-Spaltung von Descartes
René Descartes (1596 – 1650) gilt heute allgemein als Vater der modernen Philosophie und als philosophischer Begründer des modernen naturwissenschaftlichen Denkens. Eine seiner wichtigsten Anschauungen besagt, dass in der geschaffenen Welt grundsätzlich zu unterscheiden sei zwischen den erkennenden Subjekten und den räumlich ausgedehnten Objekten. Die Subjekte sind somit grundsätzlich gedacht als für sich bestehende Wesenheiten ohne notwendigen Bezug zur Objektwelt, und ebenso existieren gemäss dieser Ansicht die Objekte unabhängig und ausserhalb vom menschlichen Erkennen.
Auf der Grundlage dieser Betrachtungsweise kommt der Wahrnehmung durch die Sinne die Funktion zu, dem wahrnehmenden Subjekt Kunde zu geben von der objektiv gegebenen Beschaffenheit der dinglichen Welt. Daraus ergibt sich eine aus heutiger Sicht zu wenig differenzierte Wahrnehmungstheorie, die den wahrnehmenden Menschen mehr oder weniger als bei der Geburt grundsätzlich leeres Gefäss annimmt, das im Verlaufe des Lebens durch immer neue Wahrnehmungsakte allmählich angefüllt werden kann.
2 Kritik der Phänomenologie am cartesianischen Denken
Die Schwächen dieser Theorie wurden von der späteren Philosophie und insbesondere von der modernen Psychologie vielfach aufgedeckt. Der nachfolgend entwickelte Standpunkt wird von der als ‚Phänomenologie‘ bezeichneten philosophischen und psychologischen Richtung vertreten. Grundlegend sind die folgenden Erkenntnisse:
- Das Subjekt und das Objekt dürfen nicht als grundsätzlich getrennte Gegebenheiten verstanden werden, sondern sind vielmehr zwei Pole in einem beide umfassenden Geschehen. Man könnte sie mit den Brennpunkten einer Ellipse vergleichen: Alle Strahlen, die von F1 ausgehen, sammeln sich, indem sie durch die Peripherie der Ellipse reflektiert werden, in F2 – und umgekehrt.
Vergegenwärtigen wir uns die Konsequenzen dieser Auffassung im Hinblick auf das Subjekt: Das Subjekt (das Ich) ist demnach nichts in sich Feststehendes, gegen aussen Abgeschlossenes, das sich ohne Bezug zu irgendwelchen Objekten denken liesse, sondern gewinnt seine jeweilige Gestalt vielmehr in der Art und Weise, wie es sich in jedem Augenblick auf die Objekte – die Dingwelt – bezieht. Es gibt somit kein „leeres Bewusstsein“, das wie ein leeres Gefäss zu füllen wäre, sondern „Bewusstsein“ bedeutet immer schon „Bewusstsein von etwas“. Die Objekte, worauf sich das Subjekt in seinem bewussten Sein bezieht – d. h. mit welchen es sich durch die Akte der Wahrnehmung verbindet – gestalten das Wesen des wahrnehmenden Subjekts wesentlich mit. Ein „leeres“ Subjekt, ohne allen Bezug zu Objekten, ist nicht denkbar. Es lässt sich daher mit vollem Recht sagen, dass ein Mensch, der sich in seinen Wahrmehmungen beispielsweise auf ein kriegerisches Ereignis bezieht, anders ist als dann, wenn er sich in seiner Wahrnehmung mit einer blühenden Wiese verbindet.
Auch die Objekte – verstanden als durch unser Bewusstsein in ihrem So-Sein erkannte Sachverhalte – dürfen nicht aufgefasst werden als an sich selbst, d. h. unabhängig vom subjektiven Bewusstsein bestehende Gegebenheiten. Die physikalischen Wirkungen, die von der Dingwelt ausgehen, sind ohne ein wahrnehmendes Subjekt (ein Wesen, das dafür empfänglich ist) noch keine Reize; sie werden es erst durch die sinnliche Empfänglichkeit des Menschen (und der übrigen Lebewesen). Darüber hinaus ist das gesamte Reiz-Angebot völlig chaotisch und muss daher – im Akt des Wahrnehmens – vom Subjekt erst strukturiert, d.h. zu bedeutungsvollen Sinnganzen (zu „Gestalten“) geordnet werden. Insofern konstituieren sich (‚entstehen‘) die Objekte erst im Akt der Wahrnehmung und sind in mehr oder weniger starkem Grade abhängig vom wahrnehmenden Subjekt. Daher sind selbst dann, wenn identische Reize auf die Sinnesorgane verschiedener Subjekte treffen, die Wahrnehmungen verschieden. Nicht zwei Subjekte nehmen dasselbe Reizfeld auf die nämliche Weise wahr.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Im Wahrnehmungsprozess gleicht sich einerseits das Subjekt an die Welt (die Objekte) an, andererseits organisiert sich in seinem Bewusstsein gleichzeitig eine Objektwelt, die in hohem Masse von seinen individuellen Voraussetzungen her bestimmt ist.- Die Bewusstseins-Entwicklung ist demgemäss kein additiver Prozess, bei dem gewissermassen zum bereits vorhandenen Bestand von Bewusstseinsinhalten durch jeden neuen Wahrnehmungsakt einfach etwas Neues hinzugefügt wird; was und in welcher Weise ein Subjekt wahrnimmt, hängt von seiner ganzen bisherigen Entwicklungsgeschichte ab, und jeder neue Wahrnehmungsakt vermag grundsätzlich früher erfolgte Wahrnehmungen umzudeuten und in ein neues Licht zu rücken.
- Aus all dem folgt, dass der Prozess der Wahrnehmung keinesfalls als Vorgang zu verstehen ist, in welchem das Subjekt ein passiver Empfänger von an sich schon bedeutungsvollen Reiz-Konfigurationen ist. Zwar wird die im Wahrnehmungsakt zu leistende Deutungsarbeit meist unbewusst und unwillkürlich vollzogen, aber das Subjekt ist dessen ungeachtet grundsätzlich aktiv.
3 Der Ansatz der Gestaltpsychologie
3.1 Grundgedanken
Die Vertreter der ‚Berliner Schule‘ (Begründer: M. Wertheimer, K. Koffka, W. Köhler, K. Lewin) wenden sich gegen den ‚Elementarismus‘, der alle komplexen Sachverhalte (Bewusstsein, Erleben, Wahrnehmung etc.) letztlich als eine Zusammensetzung von einfachsten basalen (grundlegenden) Elementen betrachtet. Die Gestaltpsychologen vertreten demgegenüber den Standpunkt, dass ‚das Ganze vor den Teilen‘ sei, d.h. dass die Teile eines komplizierten Sachverhalts letztlich nur in ihrer Funktion als Elemente eines übergeordneten Ganzen sinnvoll verstanden werden können. Immer, wenn Teile aus einer Ganzheit herausgelöst werden, geht etwas verloren, das nur im Ganzen, aber niemals in den Teilen zu finden ist. Der unumstössliche Grundsatz der Gestaltpsychologie lautet demgemäss: „Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile.“ Goethe lässt diesen Gedanken im ‚Faust‘ vom Zyniker Mephistopheles aussprechen:
|
„Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, |
Die eigenständigen, übergeordneten Ganzheiten werden von den Vertretern der Berliner Schule als ‚Gestalten‘ bezeichnet.
| Definition: Eine Gestalt ist die letzte, nicht mehr reduzierbare Einheit (Ganzheit) und ist übersummativ, d. h. mehr als die Summe ihrer Teile. Sie ist von der Umgebung abgehoben, gegliedert, aber in sich geschlossen. |
Beispiel: Das Erscheinungsbild des menschlichen Leibes kann als Gestalt angesprochen werden. Er ist keinesfalls eine Zusammensetzung von Rumpf, Armen, Beinen und Kopf, denn alle diese Teile können nicht isoliert bestehen (und zwar nicht nur physiologisch verstanden, sondern auch in ontologischer [seinsmässiger] Hinsicht), sondern werden zu dem, womit sie unsere Sprache bezeichnet, erst durch ihren Bezug zum Ganzen. Christian Morgenstern macht uns in einem seiner Galgenlieder in überraschender Weise auf diesen Zusammenhang aufmerksam:
|
Das Knie Ein Knie geht einsam durch die Welt. |
Im Kriege ward einmal ein Mann erschossen um und um. Das Knie allein blieb unverletzt als wär’s ein Heiligtum. |
Seitdem geht’s einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. |
Fassen wir dann einen einzelnen Teil – z.B. den Kopf – ins Auge, so haben wir wiederum eine in sich gegliederte Gestalt vor uns, die mehr ist als eine Zusammensetzung von Ohren, Augen, Nase, Mund und Haaren. Alle diese Teile verstehen sich wiederum in ihrem So-Sein nur im Bezug auf das übergeordnete Ganze. Das wiederholt sich wieder, wenn wir z.B. das Auge gesondert betrachten: Auch dieses Gebilde ist mehr als eine Zusammensetzung von Elementen, sondern wiederum ein in sich geschlossenes sinnvolles Ganzes, eben eine Gestalt. Man kann diesen Weg vom grössern Ganzen in immer kleinere Ganzheiten beliebig fortsetzen. Was wir auch immer wahrnehmen, immer ist es an sich schon eine Gestalt, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. – All das gilt natürlich nicht nur für den menschlichen Organismus, sondern schlichtweg für jedes wahrnehmbare Objekt.
3.2 Das Prägnanzgesetz
Aus der ganzheitlichen Betrachtungsweise der Gestaltpsychologie folgt als Konsequenz die Erkenntnis, dass wir in der Wahrnehmung nicht beziehungslose Reize als Elemente erfassen und sie nachträglich assoziativ zu sinnvollen Ganzheiten verbinden, sondern dass Wahrnehmen an sich schon die Erfassung von Ganzheiten im Reizfeld bedeutet, dass wir also immer Gestalten als Einheiten wahrnehmen.
Ferner unterliegt unsere Wahrnehmung insgesamt der allgemeinen Tendenz, überall möglichst gute Gestalten zu erfassen. Merkmale einer guten Gestalt sind: Gesetzmässigkeit, Einfachheit, Stabilität, Symmetrie, Geschlossenheit, Einheitlichkeit, Ausgeglichenheit, Knappheit und – im visuellen Bereich – Orientierung nach Senkrecht-Waagrecht. Dabei müssen selbstverständlich im Einzelfall nicht alle diese Merkmale zutreffen. Der wahrnehmende menschliche Geist ist jedoch so geschaffen, dass er ein Reizfeld gewissermassen idealisiert, indem er es möglichst vielen dieser Merkmale angleicht.
So zeigt sich z.B. die Tendenz zur Gesetzmässigkeit, Symmetrie, Geschlossenheit und Knappheit darin, dass wir Objekte als ‚rund‘, ‚rechteckig‘, ‚elliptisch‘ usf. ansprechen, auch wenn sie diesen idealen geometrischen Gebilden nur sehr grob entsprechen. Die Tendenz zur Einfachheit und Einheitlichkeit drückt sich u. a. darin aus, dass wir z. B. einen Baum als ‚grün‘ bezeichnen, obwohl eine exakte Analyse zeigt, dass ein grosser Teil des Farbspektrums vertreten ist. Oder die Stabilität von Gestalten ersehen wir daraus, dass wir irgendwelche Gebilde fast beliebig wenden oder gar verformen können, ohne dass sich uns der Gedanke aufdrängt, wir hätten es bei jeder Veränderung mit einer andern Gestalt zu tun. So kann man beispielsweise eine bekannte Melodie (es gibt eben auch akustische Gestalten) auf alle möglichen Arten ‚falsch‘ singen oder spielen, und trotzdem sprechen wir sie immer noch als dieselbe Melodie an. Die Guggenmusiker machen sich diesen Sachverhalt ausgiebig zu Nutze.
Die Stabilität von Gestalten führt auch dazu, dass sie grundsätzlich transponierbar sind: Man kann sie in andere Situationen verschieben, in andere Zusammenhänge stellen, so dass sich die Reize unter rein physikalischem Gesichtspunkt vollkommen ändern – und trotzdem werden sie als identische Gebilde angesprochen. So halten wir z. B. ein Farbbild für dasselbe, auch wenn es seine Farben unter geänderten Lichteinwirkungen insgesamt verändert, und ebenso bleibt für uns eine Melodie identisch, auch wenn wir sie in verschiedenen Tonlagen hören und sie somit – physikalisch gesehen – etwas völlig anderes geworden ist.
Die Gestaltpsychologen formulieren das Prägnanzgesetz so:
| „Jede psychologische Organisiertheit (z.B. visuelle oder akustische Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle, Willensakte; AB) zeigt eine Tendenz in eine bevorzugte Richtung, sie bewegt sich immer in Richtung auf den Zustand der Prägnanz („Knapp und doch vielsagend“), d. h. in Richtung auf die ‚gute‘ Gestalt.“ |
(Anmerkung: Psychologische Anfänger neigen dazu, den Begriff „gute Gestalt“ als eine Wertung, sogar als eine moralische Wertung zu verstehen und sind dann z.B. irritiert, wenn man von wahrnehmungspsychologischer Warte aus auch alle Vorurteile – etwa „der faule Afrikaner“ – als gute Gestalt bezeichnet.)
3.3 Figur und Grund
Gestalten treten stets als Figur hervor und weisen den übrigen Reizen die Bedeutung des Grundes zu, von dem sie sich abheben. Die Figur ist begrenzt, der Grund unbegrenzt. Die Figur ist bestimmt, fest, geschlossen, der Grund locker, unbestimmt, offen. Die Figur tritt hervor, der Grund zurück. Das gilt nicht bloss im visuellen Bereiche, sondern auch in jedem andern (z.B. im akustischen Bereich, im Gefühlsbereich, beim Denken usf.).
3.4 Das Chaos ist nicht wahrnehmbar
Aus all dem bisher Gesagten ergibt sich, dass das Chaos – verstanden als vollkommener Wirrwarr beziehungsloser Reize – weder wahrgenommen noch vorgestellt werden kann, weil das Wahrnehmen und das Vorstellen (als inneres Wahrnehmen) an sich schon ein ordnender, Gestalten bildender Prozess ist. Das Chaos lässt sich daher lediglich denken, ist mithin völlig abstrakt. Aus wahrnehmungspsychologischer Sicht ist z.B. der Zustand der Anarchie, „wo das totale Chaos herrscht“, durchaus kein Chaos, sondern eine Gestalt bzw. eine Struktur von Gestalten.
3.5. Was uns Kippfiguren und Vexierbilder lehren

Unter ‚Kippfiguren‘ verstehen wir zeichnerische Gebilde, welche bewusst so gestaltet sind, dass die optische Reizkonfiguration zwei verschiedene Deutungen zulässt. So kann man z. B. in derselben Figur entweder eine alte oder eine junge Frau sehen, ein Gefäss oder zwei gegeneinander gerichtete Gesichts-Profile, eine Maus oder einen Männerkopf usf. Diese Bilder machen uns bewusst, dass beim Wahrnehmen nicht einfach Reize auf unserer Netzhaut abgebildet und mechanisch ins Gehirn geleitet werden, sondern dass wir gar nicht anders wahrnehmen können, ohne Gestalten zu bilden und diese zu deuten. Dieser Sachverhalt wird besonders eindrücklich dadurch belegt, dass wir im selben Augenblick stets nur eine Figur sehen können und dass, wenn die andere Figur gesehen werden soll, die Deutung schlagartig umkippt. Dasselbe erleben wir beim Betrachten von ‚Vexierbildern‘. In diesen Zeichnungen, welche früher fast zwingend auf die Unterhaltungsseite von Zeitschriften und Zeitungen gehörten, werden bewusst irgendwelche Figuren auf raffinierte Weise versteckt, so dass man oft sehr lange suchen muss, bis sich einem alle möglichen Bestandteile von Bäumen, Wolken, Gerätschaften usf. sowie die bewusst so gestalteten Zwischenräume zur gesuchten Gestalt zusammenfügen wollen. Auch hier geht es darum, in einem bewusst diffus gehaltenen Reizangebot Gestalten zu bilden. In vielen Kippfiguren und Vexierbildern beruhen die überraschenden Effekte auf einer Umdeutung von Figur und Grund. Der Augenblick, in welchem sich in unserem Bewusstsein die gesuchte Gestalt oder – bei Kippbildern – die neue Deutung einstellt, ist gekennzeichnet und erfüllt durch das Erlebnis der freudigen Überraschung, das die meisten Menschen durch einen unverwechselbaren Gesichtsausdruck und durch Ausrufe wie ‚Ah‘ oder ‚Aha‘ zum Ausdruck bringen („Aha-Erlebnis“).
3.6 Die Wesensgleichheit von ‚Wahrnehmung‘ und ‚Lernen durch Einsicht‘
Dieses ‚Aha-Erlebnis‘ belegt, dass Einsicht in die Problematik stattgefunden hat. Daraus ersehen wir, dass letztlich das Wahrnehmen als einsichtiges Erfassen von Gestalten identisch ist mit dem einsichtigen Lösen von Problemsituationen. In beiden Fällen geht es darum, etwas als grundsätzlich problematisch Empfundenes plötzlich richtig, d. h. als gedeutete Gestalt, zu sehen. So bedeutet das ‚Aha‘, wenn ich mich im Nebel einem Schatten nähere und sich dieser schliesslich als Bauernhaus entpuppt, dasselbe, wie wenn sich ein Kind im Nebel seiner Gedanken dem Problem nähert, wieviel denn nun 10 kg Äpfel kosten, wenn es für 5 kg sechs Franken bezahlt, und es plötzlich einsieht, dass die doppelte Menge zur Verdoppelung des Preises führen muss. Die noch offene Problemsituation lässt sich verstehen als ’nicht geschlossene Gestalt‘, und die plötzliche Einsicht in die Zusammenhänge ist gleichbedeutend mit dem ‚Schliessen einer offenen Gestalt‘. Auf die Wesensgleichheit von ‚Wahrnehmen‘ und ‚Erkennen‘ deutet auch der sprachliche Ausdruck hin: Wahrnehmen heisst eben, „etwas für wahr nehmen“, also: es erkennen.
3.7 Wahrnehmungsbedingungen
Wird Wahrnehmen als wechselseitiger Prozess verstanden, so gibt es grundsätzlich zwei Bedingungsfelder, die den Wahrnehmungsprozess bestimmen:
Einerseits sind es Bedingungen, die im Reizfeld selbst gegeben sind (objektive Bedingungen),
andererseits sind es Bedingungen, die sich im wahrnehmenden Subjekt vorfinden (subjektive Bedingungen).
Die Gestaltpsychologen haben diese Bedingungen untersucht, wobei sie jenen, die im Reizfeld selbst gegeben sind und welche die Bildung identischer Gestalten durch unterschiedliche Subjekte begünstigt, ein besonderes Gewicht beigemessen haben. Diese objektiven Bedingungen wurden in den ersten fünf ‚Gestaltgesetzen‘ festgehalten. Sie sagen aus, wie die Mehrzahl der wahrnehmenden Subjekte Reizsituationen strukturiert, in welchen ganz bestimmte Bedingungen objektiv gegeben sind. Mit den subjektiven Bedingungen befasst sich das sechste Gestaltgesetz.
3.7.1 Die fünf Gestaltgesetze als objektive Wahrnehmungsbedingungen
Die fünf Gestaltgesetze können verstanden werden als Konkretisierungen des Prägnanzgesetzes; sie sind diesem folglich untergeordnet. Aus ihnen geht hervor, dass es Bedingungen in optischen Reizfeldern gibt, die bei der Mehrzahl der Menschen – unabhängig von individuellen Unterschieden – zu denselben Gestaltbildungen führen. In einer konkreten Situation wirken zumeist mehrere der im folgenden dargestellten Gesetze. Je nach Situation kann das eine stärker wirken als die andern.
3.7.1.1 Das Gesetz der Nähe
Die Zusammenfassung der Teile eines Reizganzen erfolgt unter sonst gleichen Umständen im Sinne des kleinsten Abstandes.
Aufgefordert, diese Darstellung in eine mathematische Formel umzuwandeln, sagen alle, die nicht durch kokette Starrköpfigkeit auffallen wollen: 1 + 2 + 4. Natürlich wäre – mathematisch – auch 2 + 2 + 3 richtig, sofern man die Grenze zwischen den Gruppen anders zieht. Ebenso wird man in der folgenden Darstellung 4 Kolonnen zu je 5 Punkten und nicht 5 Reihen zu 4 Punkten sehen:

3.7.1.2 Das Gesetz der Gleichheit (der Ähnlichkeit)
Sind mehrere verschiedenartige Elemente wirksam, so besteht unter sonst gleichen Umständen eine Tendenz zur Zusammenfassung der gleichartigen Elemente zu Gruppen.
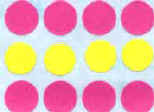
So schliessen sich in dieser Figur trotz gleichem Abstand die Punkte gleicher Farben zu Gestalten zusammen. Die Gleichartigkeit kann sich auch auf einen Teilinhalt der Elemente beziehen, etwa darauf, dass sie mit einem Zeichen markiert sind oder die gleiche Form haben.
3.7.1.3 Das Gesetz der Geschlossenheit
Die Linien, die eine Fläche umschliessen, werden unter sonst gleichen Umständen leichter als eine Einheit aufgefasst als diejenigen, die sich nicht zusammenschliessen.
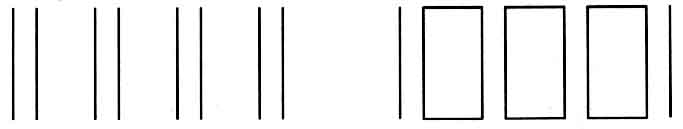
In der Strichgruppe links schliessen sich die Linienelemente 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 usw. zu Streifen zusammen, in der rechts stehenden Gruppe dagegen 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7 usw. Müsste man die Anordnung der senkrechten Linien mathematisch ausdrücken, hiesse die Rechnung für die linke Seite 2 + 2 + 2 + 2, jene für die rechte Seite aber 1 + 2 + 2 + 2 + 1. Das Gesetz der Geschlossenheit ist für die optische Gliederung des Gesichtsfeldes in Objekte, seien diese nun bekannt oder unbekannt, von grosser Wichtigkeit.
3.7.1.4 Das Gesetz der durchgehenden Kurve (der guten Fortsetzung)
Diejenigen Teile einer Figur, die eine durchgehende Kurve ergeben, bilden leichter Einheiten. – Dieses Gesetz verhütet in vielen Fällen, dass sich Teile, die verschiedenen Gegenständen angehören, zusammenschliessen, mit andern Worten, es hilft, dass man optisch in Berührung stehende Objekte richtig „auseinandersieht“. Die Umrisslinien dieser Teile verschiedener Gegenstände bilden eben keine gute Kurve miteinander.
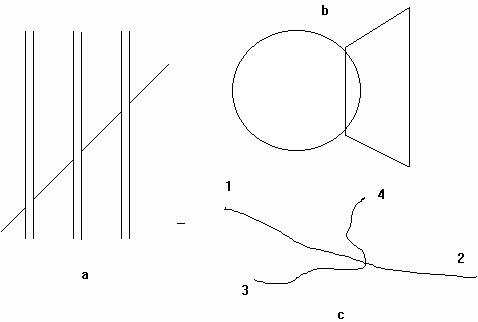
In Figur a sieht man eine gerade Linie, die durch davorliegende Streifen unterbrochen erscheint, d. h. man kommt nicht etwa spontan auf die Idee, wir hätten es mit einem Gebilde zu tun, das links und rechts aus einem um jeweils 45 Grad abgewinkelten, unproportionierten T und zwei dazwischen eingeklemmten H bestehe.
Figur b zerfällt deutlich in Kreis und Trapez, obwohl auch die Zusammenfügung eines angeschnittenen Kreises und eines trapezförmigen Gebildes, dessen Decklinie konkav gebogen ist, denkbar wäre.
Und in Figur c schliessen sich die Abschnitte 1 und 2 sowie 3 und 4 zusammen, obwohl andere Kombinationen grundsätzlich möglich wären.
3.7.1.5 Das Gesetz des gemeinsamen Schicksals
Solche Elemente schliessen sich zusammen, die sich gemeinsam und auf ähnliche Weise bewegen oder die sich überhaupt im Gegensatz zu andern ruhenden bewegen, mit andern Worten, die ein gemeinsames Schicksal haben.
Um dies zu demonstrieren, können wir beispielsweise zwei Gruppen von Punkten, die jede für sich und auch in Kombination chaotisch wirken, auf eine Leinwand projizieren. Die Punkte wirken als reine Summe (sie sind nicht gesetzmässig gegliedert). Bewegen wir nun den einen Projektionsapparat, so schliesst sich die ihm zugeordnete Punktgruppe sofort zu einer Einheit zusammen und hebt sich von der weiterhin ruhenden ab. Das hat gleichzeitig zur Folge, dass jede der beiden Gruppen, solange die Bewegung anhält, nicht mehr chaotisch wirkt. Lässt man die bewegte Gruppe wieder zur Ruhe kommen, so werden alle Punkte wieder zu einer einzigen chaotischen Gruppe.
Andere Beispiele: 5 Strassenlaternen brennen richtig, drei flackern. Die flackernden werden zu einer Gruppe zusammengefasst, auch wenn sie nicht unmittelbar beisammen stehen. Oder: Auf der Weide galoppieren 2 Pferde, 5 Pferde stehen still, und 4 Pferde liegen. Vielleicht befindet sich bei den galoppierenden, bei den stehenden und bei den liegenden Pferden je ein Schimmel. Trotzdem werden primär nicht die drei weissen als Gruppe wahrgenommen, was dem Gesetz der Gleichheit entsprechen würde.
3.7.2 Die subjektiven Wahrnehmungsbedingungen
3.7.2.1 Das Gesetz der Erfahrung

Der Unterschied dieser beiden Gebilde besteht lediglich darin, dass das eine im Vergleich zum andern auf den Kopf gestellt ist. Während die Figur links – isoliert betrachtet – spontan kaum als sinnvolle Gestalt erfasst wird, erkennen wir in der Figur rechts, ohne dass wir es verhindern könnten, die Schattenlinien eines plastisch gedachten Buchstabens E, und man glaubt möglicherweise sogar deutlich die nicht gezeichneten Grenzlinien zu sehen.
Dieser Tatbestand zeigt, dass die Bedingungen für die Art und Weise, wie sich in unserem Bewusstsein Gestalten bilden, nicht ausschliesslich auf der Objektseite liegen, denn die Gestalt des Buchstabens E wird natürlich nur von solchen Subjekten gebildet, welche die lateinische Schrift kennen, d.h. welche Erfahrungen mit dieser Gestalt gemacht haben.
Allgemein lässt sich feststellen: Alles, was ein Subjekt einer gegebenen Reizsituation an Erfahrungen (Wissen, Erinnerungen) entgegenträgt, ist ein integrierender Bestandteil des Wahrnehmungsaktes und dafür mitverantwortlich, in welcher Weise sich im Wahrnehmungsprozess Gestalten bilden. Die Gestaltpsychologen bezeichnen solche Inhalte des Bewusstseins (und auch des Unbewussten), welche die Gestaltbildung in eine ganz bestimmte Richtung lenken, als ‚Gestaltdispositionen‘. Die Bedeutung solcher Gestaltdispositionen kommt im bekannten Satz Goethes zum Ausdruck: „Man weiss nur, was man sieht, und man sieht nur, von dem man weiss.“
3.7.2.2 Verschiedene Arten von Gestaltdispositionen
- Die Erfahrung kann sich auf die Gestalten selbst beziehen. So vermögen wir beispielsweise Farbflecke in einem Bild nur darum als Blumen zu identifizieren, weil wir bereits Erfahrungen mit Blumen gemacht haben.
- Die Erfahrung kann aber auch den Umgang mit gleichen oder ähnlichen Reizsituationen betreffen. So kann man beispielsweise nicht ohne weiteres Steinböcke im Geröll entdecken, wenn man sie isoliert als solche zu erkennen vermag, sondern man muss vielmehr darin geübt sein, die Tiere in einer ganz bestimmten, farblich sehr ähnlichen Umgebung wahrnehmen zu können. Der erfahrene Wildhüter sieht daher mehr als ein Laie.
- Auch die unmittelbar vorausgehende Wahrnehmung kann in den nächsten Wahrnehmungsakt einfliessen und als Erwartung zur Bildung ganz bestimmter Gestalten führen.
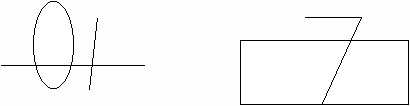
Fragt man z.B. einen unvoreingenommenen (d.h. keiner bestimmten Erwartung unterliegenden) Betrachter, was er auf der Figur links sehe, so erhält man in der Regel die Antwort: eine waagrecht liegende Strecke, die von einem Oval und einer kleineren, schräg gestellten Strecke gekreuzt wird. Macht man indessen den Betrachter darauf aufmerksam, es sei in der Figur eine Ziffer verborgen, so wirkt diese Information als Erwartung, weshalb die versteckte 4 leicht gefunden werden kann. Fragt man ihn dann weiter, was er in der Figur rechts sehe, so nennt er mit grosser Wahrscheinlichkeit die Ziffer 7. Die unmittelbar vorausgegangene Erfahrung hat seine Erwartung in eine bestimmte Richtung gelenkt, das Wahrnehmen wurde vorstrukturiert.
Die Erwartung entsteht indessen nicht nur durch unmittelbar vorausgehende Wahrnehmungsakte, sondern kann auch durch sprachliche Vermittlung oder eigenes Denken und Vorstellen geweckt werden. Deshalb lässt sich der Wahrnehmungsakt entweder durch andere Subjekte oder durch das eigene Bewusstsein steuern. Das geschieht immer dann, wenn wir z.B. als Lehrer die Aufmerksamkeit der Schüler durch unsere Sprache auf eine bestimmte Sache lenken oder wenn wir eine bestimmte Sache – die dann eben als Gestalt in unserer Vorstellung lebt – suchen.
Der Wahrnehmungsprozess wird aber nicht nur stark dominiert durch das, was wir erwarten, sondern ebenso sehr durch das, was unserer Erwartung markant widerspricht. So nehmen wir den Inhalt der Gespräche in einer Menschenmenge kaum wahr, würden aber sofort aufmerksam, würde einer laut das ‚Vater unser‘ beten. Oder: Es erklingt ein uns bekanntes Musikstück, ohne dass wir jeden Ton bewusst wahrnehmen, aber sobald dem Interpreten ein Fehler unterläuft, werden wir aufmerksam.
Nicht alles, was auf der Subjektseite den Wahrnehmungsprozess beeinflusst, lässt sich ohne Künstlichkeit als Erfahrung deklarieren. Weitere Gestaltdispositionen sind:
Der momentane Bedürfniszustand: Ein Hungriger sieht vor allem Nahrung anpreisende Plakate und Spezereiläden, ein Durstiger nimmt insbesondere Gasthäuser wahr, und ein Ermatteter bevorzugt in seiner Wahrnehmung Bänke und Betten.
Momentane Stimmungen und Gefühle: Verliebte sehen alles in Rosa, Pessimisten alles in Schwarz. Begeisterten erscheint alles leicht zu bewältigen, Verzagten alles schwierig usf.
Interessen, Werthaltungen: Ein Hobby-Fotograf sieht anderes beim Durchblättern einer Illustrierten als der Durchschnittsleser. Ornithologen hören alle Vögel, Botaniker sehen jede Blume, und wer Blondinen bevorzugt, übersieht womöglich die sympathischste Brünette.
Individuelle Gegebenheiten im Unbewussten: All das bisher Genannte ist grundsätzlich dem Bewusstsein zugänglich. Nun konnte aber die Tiefenpsychologie nachweisen, dass der Mensch nicht nur aus unbewussten Motiven heraus handelt, sondern dass das Unbewusste auch in die Wahrnehmungsakte einfliesst und sie wesentlich mitstrukturiert. Adler nennt diesen Sachverhalt ‚tendenziöse Apperzeption‘, Freud bezeichnet ihn als Projektion. Das, was in der eigenen Seele nicht wahrgenommen werden will oder kann, wird in der Aussenwelt gesehen. So sind verdrängte Ängste, Schuldgefühle, Aggressionen, Wünsche für die Art unserer Wahrnehmungen in hohem Masse mitverantwortlich. Die Psychologie macht sich heute mit den projektiven Tests diese Tatbestände zu Nutze, indem sie von den Wahrnehmungen der Menschen auf ihr Unbewusstes zurückschliessen. So wird z.B. der Proband im Rorschach-Verfahren aufgefordert, die auf 10 genormten Tafeln vorgelegten symmetrischen Kleckse zu deuten. Im Thematic Apperzeption Test (TAT) werden ihm 20 Bilder, die bewusst vieldeutig gestaltet sind, zur Deutung vorgelegt. Oder im Szondi-Test muss er aus vielen Fotos von Kriminellen und Psychopathen die sympathischsten und unsympathischsten auswählen. In allen Fällen gestatten die vorgelegten Deutungen und Wahlen Rückschlüsse auf die Struktur des Unbewussten. Es gibt noch viele andere projektive Tests.
3.7.2.3 Die soziale Bedeutung der subjektiven Wahrnehmungsbedingungen
Der Umstand, dass die Menschen ihre Umwelt nicht unterschiedslos gleich – eben objektiv – wahrnehmen, ist die Ursache für unendlich viele zwischenmenschliche Konflikte. Sie werden um so verbissener ausgetragen, je weniger den Betroffenen die dargelegten Zusammenhänge klar sind. Wer akzeptieren kann, dass der andere vieles anders sieht, kommt ihm dadurch bereits einen Schritt entgegen.
4 Einige didaktische Konsequenzen
Als jungem Lehrer sind mir die oben dargestellten Zusammenhänge erstmals aufgegangen, als ich den Schülern voller Begeisterung in der Geographie meine Bilder zeigte und dann ernüchtert feststellen musste, dass sie ihnen in keiner Weise den erhofften Eindruck machten. So hängte ich beispielsweise ein Bild des berühmten Grand Cañon auf und erwartete, das löse bei den Schülern dasselbe Staunen aus, das mich jedes Mal ergreift, wenn ich solche Bilder sehe. Aber nichts dergleichen geschah. Sie hatten eine andere Lebensgeschichte als ich und hatten auch, da sie ja viel jünger waren, bedeutend weniger erfahren. Mich hat es in meiner Kindheit immer ergriffen, wenn ich mit Sand und Wasser spielte und mitverfolgen konnte, wie das fliessende Wasser gewaltige Täler in meine Sandberge grub. Auch ist ein Bachtobel für mich heute noch ein Ort, der mich fesselt, weil hier die zugleich zerstörende und gestaltbildende Kraft des Wassers sinnenfällig vor Augen tritt. Als ich einmal auf einer Schulreise in den berühmten Illgraben im Kanton Wallis (Schweiz) hinunter schaute, wurde mir fast schwindlig vor Erregung. Alle diese Erfahrungen fliessen ein in mein Erleben, wenn ich nun Bilder jener Landschaft sehe, wo das Wasser eine mehrere Hundert Kilometer lange und teilweise 1800 m tiefe Rinne in die Erdkruste gerissen hat.
Wir dürfen deshalb als Lehrer niemals erwarten, dass die Schüler dasselbe sehen und erleben wie wir, wenn wir ihnen etwas zeigen. Schon diese Erkenntnis, in Fleisch und Blut übergegangen, bringt uns im Verständnis unserer Schüler einen Schritt voran.
Insofern wir nun feststellen, dass wir selbst beim Betrachten eines Gegenstandes oder eines Bildes mehr und Wesentlicheres erleben als unsere Schüler, haben wir als Lehrer natürlich die Aufgabe, die Schüler in ihrem Wahrnehmungserlebnis einige Schritte voran zu bringen. Wie kann das geschehen?
Erstens muss der Gegenstand oder das Bild gewichtig sein, d. h. ins Zentrum des Interesses gerückt werden. Das geht nur, wenn wir die Schüler nicht mit Bildern überschwemmen, sondern gezielt auswählen und dabei die Schüler erfahren lassen, dass uns das Vorgezeigte wichtig ist. Ohne Aufmerksamkeit und Konzentration kann kein in die Tiefe gehendes Wahrnehmungserlebnis entstehen.
Zweitens ist es oft richtig und zweckmässig, die Betrachtung eines Bildes vorzubereiten. Im obgenannten Beispiel hiesse das etwa, die landschaftsbildende Wirkung des Wassers zuerst im Sandkasten und in einem Bachtobel erleben zu lassen.
Drittens ist es entscheidend, dass intensiv über einen Gegenstand oder ein Bild gesprochen wird. Zuerst mögen die Schüler einbringen, was sie alles sehen und woran sie das Gesehene sonst noch erinnert. Sodann ist es Aufgabe des Lehrers, seinerseits mit einer möglichst farbigen Sprache darzulegen, was ihm selbst der Gegenstand oder das Bild bedeutet und welche Erfahrungen seinem eigenen Wahrnehmungserlebnis zu Grunde liegen. Erfahrungen sind nämlich, da sie sich sprachlich in Begriffe fassen lassen, in einem bestimmten Grade vermittelbar. Die Sprache ermöglicht es dem Menschen, seine Mitmenschen wenigstens ein Stück weit an seinem eigenen Erleben teilnehmen zu lassen.
Was hier dargelegt wurde, steht in Übereinstimmung mit Pestalozzis Begriff der Anschauung. Ihm wurde die Einsicht wichtig, dass wir Menschen, um unsern Horizont zu weiten, alle Sinne optimal zur Wahrnehmung der Welt einsetzen müssen, dass dies aber nicht genügt, sondern dass die Anschauungen im Bildungsprozess stets mit Sprache verbunden sein müssen. Schliesslich fordert er aber auch, dass die Sinneswahrnehmung und die Sprache mit der Liebe zu verbinden seien, damit das Wahrnehmungserleben nicht kalt bleibt, sondern zu einer echten, liebenden Begegnung mit der Welt und jenen Menschen führt, die uns in der gemeinsamen Anschauung der Welt verbunden sind.

