Aspekte der Lernpsychologie
Inhaltsverzeichnis:
1 Was heisst Lernen?
2 Lernmodelle
2.1 Beobachtungslernen (Modell-Lernen, Imitationslernen)
2.2 Klassische Konditionierung
2.2.1 Der Hund von Iwan Pawlow
2.2.2 Exkurs: Das Denken in Modellen
2.2.3 Zurück zu Pawlow
2.3 Die Lehre von John B. Watson (1878 – 1958): Behaviorismus
2.4 Lernen durch Versuch und Irrtum
2.4.1 Die Katzen von Edward Thorndike
2.4.2 Exkurs: Didaktische Überlegungen
2.5 Operante Konditionierung
2.5.1 Die Tauben und Ratten von B.F. Skinner
2.5.2 Grenzen des Lernmodells ‚operante Konditionierung‘
2.5.3 Exkurs: Skinner als Philosoph
3 Behavioristische Didaktik
3.1 Ebene der Inhalte
3.1.1 Grundzüge der lernzielorientierten Didaktik
3.1.2 Das Curriculum
3.2 Ebene der Methoden
3.2.1 Der Programmierte Unterricht
3.2.2 Audio-visuelle Fremdsprach-Lehrmethode
3.3 Kritische Anmerkungen
4 Gestaltpsychologischer Ansatz
4.1 Die Schimpansen von Wolfgang Köhler
4.2 Einsichtiges Lernen beim Menschen
4.3 Das Verhältnis zwischen Lernen durch Versuch und Irrtum, einsichtigem Lernen und Übungs-Erfordernis
Um es gleich vorwegzunehmen: Es geht in diesem Text erst in zweiter Linie um das schulische Lernen. In erster Linie soll der viel allgemeinere psychologische Begriff ‚Lernen‘ geklärt werden. Gleichzeitig werden zwei psychologische Richtungen vorgestellt, nämlich die ‚Verhaltenspsychologie‘ (‚Reflexologie‘, ‚Behaviorismus‘) und die ‚Gestaltpsychologie‘ (Berliner Schule) und einige Lernmodelle besprochen, die von diesen Schulen entwickelt wurden.
Vor die Wahl gestellt, ob ich diese Theorien bloss darstellen oder dazu von meinem Standpunkt aus auch Stellung nehmen soll, habe ich mich für das zweite entschieden. Dadurch bietet sich auch die Möglichkeit, gewisse theoretische Positionen in grössere Zusammenhänge zu stellen, pädagogische und didaktische Konsequenzen zu diskutieren sowie Probleme von allgemeinerem Interesse zur Sprache zu bringen.
1 Was heisst Lernen?
Die Psychologie bezeichnet alle Äusserungen des Menschen – sich bewegen, auf Umweltreize reagieren, sprechen, handeln usf. – als Verhalten. Jeder Mensch verfügt in einem beliebigen Zeitpunkt seines Lebens über ein bestimmtes Repertoire von Verhaltensmöglichkeiten. Es ist ganz offensichtlich, dass dieses Repertoire nicht zu jedem Zeitpunkt gleich ist. Die Psychologie versucht nun die Frage zu klären, wie es dazu kommt, dass ein Mensch im Zeitpunkt A über ein anderes Verhaltensrepertoire verfügt als im Zeitpunkt B.
Grundsätzlich gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten:
- Zum einen sind Änderungen des Verhaltens zurückzuführen auf die biologische Entwicklung bzw. Zurück-Entwicklung des Organismus. Diese Prozesse der Reifung bzw. Alterung sollen uns hier nicht weiter beschäftigen.
- Zum andern treten Verhaltensänderungen ein als Reaktion auf äussere Einwirkungen (Reize). Die Psychologie bezeichnet diese Verhaltensänderungen als Lernen. Lernen hat also immer dann stattgefunden, wenn sich das Verhalten eines Menschen geändert hat.
Die einfachste Definition lautet demnach: Lernen = Verhaltensänderung
Diese Definition ist im Rahmen des Behaviorismus die grundlegende. Aber dann wäre zu fragen: Hat ein Mensch, welcher der Ausführung eines ihm neuen Vorgangs zuschaut, aber anschliessend gar nichts tut, denn nichts gelernt? Sein Verhalten hat sich ja nicht geändert. Was sich geändert hat, sind seine Verhaltensmöglichkeiten, denn er kann nun, sofern er will, etwas ausführen, das er zuvor nicht konnte. Er hat dabei aber auch seine Verhaltensmöglichkeiten nicht bloss verändert, sondern erweitert. Eine Veränderung kann ja auch in einem Verlust von Verhaltensmöglichkeiten bestehen. Das ist dann aber eben nicht ‚Lernen‘, sondern ‚Verlernen‘.
Mir scheinen darum die folgenden Definitionen präziser:
Lernen = Erweiterung der Verhaltensmöglichkeiten
Verlernen = Verringerung von Verhaltensmöglichkeiten
2 Lernmodelle
Sowohl die Behavioristen wie auch die Gestaltpsychologen sind der Frage nachgegangen, auf welchen psychischen bzw. physiologischen Grund-Prozessen diese Verhaltensänderungen (bzw. Erweiterungen von Verhaltensmöglichkeiten) beruhen. So sind verschiedene Lernmodelle entwickelt worden, was u. a. auch zeigt, dass das menschliche Lernen kein einheitlicher Prozess ist, sondern auf unterschiedliche Weise zustande kommt. Es ist allerdings nicht zu übersehen, dass die einzelnen Autoren der verschiedenen Lernmodelle zum Glauben neigten, das von ihnen beschriebene Modell sei entweder das einzig mögliche oder zumindest das wichtigste. Heute versuchen die meisten Psychologen eine Zusammenschau und lassen die verschiedenen Ansätze nebeneinander gelten.
2.1 Beobachtungslernen (Modell-Lernen, Imitationslernen)
Dank der komplexen Sinnesorganisation und dem Denkvermögen kann der Mensch seine Umwelt wahrnehmen und verstehen. Die Erfahrung mit sich entwickelnden Kindern zeigt, dass sie offensichtlich ihre Umwelt nicht einfach feststellend aufnehmen, sondern aufgrund eines inneren Triebs das Wahrgenommene so weit als möglich nachzuahmen versuchen. Dies geschieht zumeist unwillkürlich im Spiel. Auch beim erwachsenen Menschen ist die Nachahmung wichtig, z. B. beim Erwerb irgend einer Technik im Rahmen einer Berufslehre. Durch die Nachahmung eignen sich die Menschen neue Verhaltensweisen an.
(NB: Die Nachahmung kann teilweise auch mit andern Lernmodellen beschrieben werden, die weiter unten dargestellt werden, z. B. mit Lernen durch Einsicht oder operanter Konditionierung.)
Vormachen und nachmachen lassen ist auch eine grundlegende Technik des schulischen Lernens. Sie spielt insbesondere im Bereiche des Handwerklichen eine zentrale Rolle. Dazu gehört z. B. auch die Vermittlung der Technik des Schreibens.
Wer die Schüler durch Beobachtungslernen fördern will, muss folgendes beachten:
- Je grösser die Wertschätzung der Lehrperson durch den Schüler ist, desto eher ist er bereit, vorgemachtes Verhalten nachzuahmen – und umgekehrt. Die Pflege der Lehrer-Schüler-Beziehung ist somit auch von diesem Gesichtspunkt her entscheidend.
- Das Vorgemachte muss dem Schüler erreichbar erscheinen. So kann z. B. der Weltmeister im Geräte-Turnen einen normal begabten Schüler im allgemeinen weniger gut zur Nachahmung motivieren als jemand, der das Geräteturnen durchschnittlich gut beherrscht und sogar da und dort deutlich Mühe bekundet.
- Die nachzuahmende Fertigkeit muss in überschaubare Teilfertigkeiten unterteilt werden, die einzeln geübt werden. Treten auch dann noch grössere Schwierigkeiten auf, sind diese Teilfertigkeiten nochmals zu unterteilen.
- Ein Bewegungsablauf muss mehrmals und langsam vorgemacht werden. Die Steigerung des Tempos ergibt sich allmählich von selbst durch stetige Wiederholung und muss daher nicht vorgemacht werden.
- Auch die Verbindung einer neu gelernten Teilfertigkeit mit dem bereits vorhandenen Verhaltensrepertoire muss systematisch geübt werden. So sind z. B. im Turnen nicht nur der Felg-Aufzug und der Unterschwung separat zu üben, sondern auch die Verbindung dieser beiden Übungsteile bedarf der Übung.
- Jedes wesentliche Element einer vorgemachten Fertigkeit muss durch die Sprache bewusst gemacht werden. Stummes Vormachen bringt im allgemeinen wenig. Ein optimaler Lerneffekt wird erzielt, wenn man die Schüler beim Nachahmen ihrerseits das Wesentliche sprachlich formulieren lässt.
Das Lernen durch Nachahmung ist in gewissen Kreisen in Verruf geraten, weil man argwöhnt, dadurch werde die Eigenart des Kindes missachtet. Man vertritt hier die Auffassung, das Kind müsse alles aus sich selbst heraus entwickeln. Ich betrachte diese Position als unpädagogisch und zwar deshalb, weil Erziehung grundsätzlich die Synthese suchen muss zwischen der Spontaneität des Kindes (das, was es von sich aus äussert) und den Inhalten der Tradition (das, was gesellschaftlich überliefert ist). Im Bereiche des Handwerklichen heisst dies, dass das Kind die Techniken, die sich teilweise über Jahrhunderte hinweg entwickelt haben, durch Nachahmung lernt, dann aber – wenn es eine Technik beherrscht – die dadurch möglich gemachten Inhalte weitgehend aus eigenen Interessen und Neigungen wählt. In diesem Zusammenhang sei an die Musik und den Sport erinnert. Wer es zu Höchstleistungen bringen will, muss bereit sein, die vorgemachten Techniken des Meisters bzw. Trainers nachzuahmen. Schon viele haben es erleben müssen, dass sie sich eine ihnen genehme Technik angewöhnten, die dann aber ein Weiterkommen verunmöglichte, weshalb es nichts anderes gab, als von vorne zu beginnen und die neue (aber bessere) Technik durch Nachahmung von Grund auf zu erwerben. Schliesslich erinnere ich an die verbreitet schlechten Handhaltungen beim Schreiben. Das ist darauf zurückzuführen, dass die meisten Kinder zeichnen oder schreiben, bevor sie in die Schule kommen, dadurch aber zumeist nicht zur richtigen Handhabung des Werkzeugs angeleitet werden.
2.2 Klassische Konditionierung
2.2.1 Der Hund von Iwan Pawlow
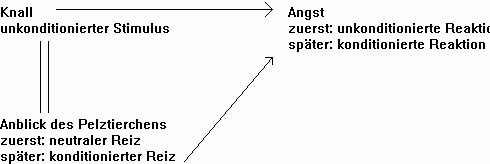
Der russische Nobelpreisträger Iwan P. Pawlow (1849 – 1936) ist einer der Begründer der Reflexologie. Nach der Machtübernahme der Kommunisten durch Lenin im Jahre 1917 hat vorerst der radikalere Michailowitsch Bechterew (1857 – 1927) auf die marxistische Psychologie gewirkt; ab 1950 trat dann wieder Pawlows Lehre in den Vordergrund, denn mit seinem materialistischen Ansatz stand er schon vor 1917 grundsätzlich auf demselben geistigen Boden wie der Marxismus. Wer in den fünfziger Jahren als Psychologe unter Stalin überleben wollte, musste sich stets befleissigen, alles, was er behauptete, durch ein Zitat Pawlows zu untermalen.
Pawlow hat mit Hunden experimentiert und deren Speichelfluss bei der Abgabe von Futter gemessen. Dabei entdeckte er, dass die Hunde schon mit Speicheln begannen, als die Schritte des Wärters zu hören waren, und nicht erst – was eigentlich zu erwarten gewesen wäre –, als das Futter vor ihnen stand. Das brachte ihn auf die Idee, den Speichelfluss künstlich – durch beliebige Reize – in Gang zu setzen. So schlug er gleichzeitig mit der Futterabgabe (insgesamt etwa 20 mal) eine Glocke an und stellte dann fest, dass der Hund auch dann Speichel aussonderte, wenn bloss die Glocke erklang und kein Futter mehr gebracht wurde. Der Hund hatte also sein Verhalten geändert; er hatte gelernt, auf einen Glockenton mit Speichelfluss zu reagieren.
Pawlow stellte dann fest, dass er auch jeden andern beliebigen Reiz einsetzen konnte, um den Speichelfluss zu provozieren, und dass der Austausch von Reizen auch bei andern Reiz-Reaktions-Verbindungen funktionierte. Er hat daher seine Erkenntnisse verallgemeinert:
Wenn man bei einer festgefügten Verbindung eines unbedingten (unkonditionierten) Reizes mit einer unbedingten (unkonditionierten) Reaktion irgend einen neutralen Reiz wiederholt gleichzeitig mit dem unbedingten Reiz abgibt, so wird nach genügend Wiederholungen die Reaktion durch den ursprünglich neutralen Reiz auch dann ausgelöst, wenn dieser allein abgegeben wird. Aus dem neutralen Reiz ist ein bedingter (konditionierter) Reiz und aus der unbedingten Reaktion eine bedingte (konditionierte) Reaktion geworden.
Die Koppelung eines neutralen mit einem unbedingten Reiz nennt man Reizsubstitution, und den gesamten Vorgang bezeichnet man als Konditionierung.
Schema, Modell der klassischen Konditionierung:
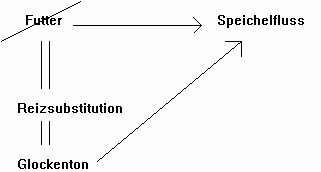
Das durchgestrichene Wort „Futter“ bedeutet: Nach einer genügenden Anzahl gleichzeitig abgegebener Reize (Futter und Glockenton gemeinsam) kann das Futter weggelassen werden, und der Glockenton löst selbständig den Speichelfluss als Reaktion aus. Aus dem ursprünglich neutralen Reiz „Glockenton“ ist jetzt ein konditionierter Reiz geworden.
Nachfolgend findet sich dasselbe Schema, diesmal die deutschen und englischen Fachausdrücke und die gebräuchlichen Abkürzungen enthaltend.
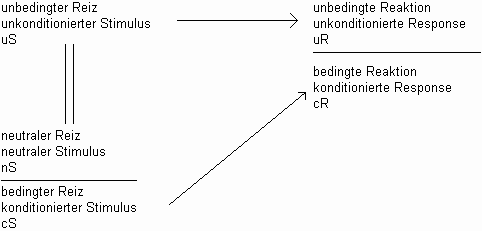
Wie wir später sehen werden, hat Skinner eine neue Art der Konditionierung beschrieben. Wir bezeichnen daher das Pawlow’sche Lernmodell als klassische Konditionierung. Der Hund ist somit darauf konditioniert worden, auf einen Glockenton mit Speichelfluss zu reagieren.
Da aus behavioristischer Sicht das Konditionieren zu einer Verhaltensänderung führt und eine Verhaltensänderung ganz allgemein als Lernen bezeichnet wird, kann der obenstehende Satz logischerweise ohne Bedeutungsänderung wie folgt umformuliert werden: Der Hund hat gelernt, auf einen Glockenton mit Speichelfluss zu reagieren.
Die Verhaltenspsychologen haben festgestellt, dass die Menschen grundsätzlich gleich lernen können wie der Pawlow’sche Hund. So hat z. B. der amerikanische Verhaltensforscher (Behaviorist) Watson den Knaben Albert darauf konditioniert, auf das Auftauchen eines Pelztierchens mit Angst zu reagieren. Er hat nämlich das Kind jedes Mal, wenn es nach dem Tierchen griff, mit einem lauten Ton erschreckt. Ursprünglich hat nur der Knall beim Knaben Angst ausgelöst. Nach der Konditionierung bewirkte der Anblick des Tierchens dieselbe Angst.
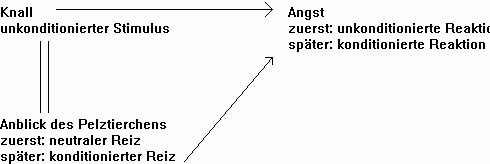
Watson hat das Pawlow’sche Modell der Reizsubstitution ergänzt durch die Reaktionssubstitution. Das heisst: Der Organismus (Mensch, Tier) kann nicht nur lernen, auf einen neuen Reiz mit einer solchen Verhaltensweise zu reagieren, die früher mit einem andern Reiz verbunden war, sondern auch, auf einen gleichen Reiz mit einer neuen Verhaltensweise zu reagieren.
Ein Beispiel: In einer Schulklasse reagieren die Schüler auf ein unverstandenes Wort mit einer entsprechenden Frage. Das unverstandene Wort ist also der unbedingte Reiz, die Frage ist die unbedingte Reaktion. Nun fordert der Lehrer die Schüler auf, bei der Fragestellung aufzustehen. Er koppelt also mit der unbedingten Reaktion (Frage stellen) eine neutrale Reaktion (Aufstehen). Später unterbleibt die Fragestellung, und die Schüler stehen bei einem unverstandenen Wort nur noch auf. Damit ist das Aufstehen zur bedingten Reaktion geworden: Die Schüler haben gelernt, auf ein unverstandenes Wort mit Aufstehen zu reagieren.
Mit Watsons Versuch am Knaben Albert kommt eine grundlegende Problematik in den Blick, die immer wieder zu grossen Auseinandersetzungen führte und noch führt, nämlich die Frage, ob und in welchem Masse Erkenntnisse, die aus Tierversuchen gewonnen wurden, ganz allgemein auf den Menschen übertragen werden dürfen. Im allgemeinen kann man folgende Feststellung machen (die im übrigen ganz logisch ist): Je mehr ein Wissenschafter einen grundlegenden Unterschied zwischen Mensch und Tier in Abrede stellt und den Menschen lediglich als die höchstentwickelte Tierart betrachtet (materialistischer Standpunkt), desto mehr ist er bereit und gewillt, auf Tierversuchen beruhende Beobachtungen ohne besondere Hemmung auf den Menschen zu übertragen. Und umgekehrt: Je stärker ein Forscher die grundsätzliche Andersartigkeit des Menschen – insbesondere seine Geistigkeit – betont (spiritualistischer Standpunkt), desto weniger ist er bereit, Erkenntnisse aus der tierischen Verhaltensforschung auf den Menschen zu übertragen.
Da ich der Ansicht bin, dass im Menschen auch Tierisches lebt, halte ich eine sehr vorsichtige und bewusst eingeschränkte Übertragung gewisser Ergebnisse aus Tierversuchen auf den Menschen für grundsätzlich vertretbar. So lässt sich beispielsweise vieles von dem, was beim Menschen automatisiert ist, mit dem Modell der klassischen Konditionierung beschreiben. Beispiel: Ein Lehrer sagt zu Beginn jeder Stunde „Bitte Ruhe!“ und klatscht gleichzeitig in die Hände. Nach einigen Wiederholungen dieser Reizkoppelungen werden die Schüler auch auf das blosse Klatschen mit Stillwerden reagieren. Der akustische Reiz (das Klatschen) ist zum konditionierten Reiz geworden und löst die richtige Reaktion selbständig aus. Der Schüler ist darauf konditioniert worden, auf das Klatschen mit Stillwerden zu reagieren.
2.2.2 Exkurs: Das Denken in Modellen
Die etwas einfältige Situation, dass Schüler beim Klatschen des Lehrers ruhig werden, soll zum Anlass einer weiterführenden philosophischen (erkenntnis-theoretischen) Überlegung werden.
Ein nicht behavioristisch eingestellter Mensch könnte nämlich einwenden, das Kind habe eben den Zusammenhang zwischen dem Wunsch und dem Klatschen des Lehrers erkannt (gemerkt, eingesehen) und es hätte etwas viel Grundlegenderes (in andern und verschiedenartigsten Zusammenhängen) gelernt: nämlich sich dem Willen des Lehrers zu fügen. Der Behaviorist würde kontern: „Vorgänge wie ‚erkennen‘, ‚merken‘, ‚einsehen‘ liegen ausserhalb meiner Betrachtungsweise und darum auch ausserhalb meines Interesses. Ich beschreibe lediglich einen von aussen beobachtbaren Vorgang und stelle fest, dass dies in gleicher Weise abläuft wie die Konditionierung des Pawlow’schen Hundes.“ Damit wird der Konditionierungsvorgang Pawlows gewissermassen zu einer begrifflichen Struktur, welche das Beobachten und Denken des Psychologen lenkt und ihm auch ermöglicht, das Wahrgenommene sprachlich zu fassen. Eine solche Denk- und Begriffs-Struktur bezeichnet man als „Modell“.
Modelle sind also Erkenntnishilfen, die unsere Wahrnehmung und unser Verstehen von vornherein in bestimmte Bahnen lenken und die sprachliche Erfassung ermöglichen. Sie liessen sich vergleichen mit einem optischen Objektiv, das so geschaffen ist, dass es bestimmte Strahlen gar nicht durchlässt (wie dies z. B. bei farbigen Gläsern der Fall ist) und dann die durchgelassenen Strahlen nach vorgegebenen Gesetzen ordnet (was z. B. bei computergesteuerten Grafiken vorliegt, welche das aufgenommene Bild in farbigen Quadraten wiedergeben.) Mit andern Worten: Modelle ermöglichen klar definierte Aussagen, blenden aber schon im Ansatz alles aus, was in ihnen nicht enthalten ist, und zwängen das, was sie zu erfassen vermögen, in einen vorgegebenen Raster. So kann man also sagen: Dass Kinder beim Klatschen des Lehrers ruhig werden, lässt sich mit dem Modell der klassischen Konditionierung wie folgt beschreiben: Der Befehl des Lehrers („Ruhe!“) ist für die Kinder ein unkonditionierter Reiz, der das Stillwerden als unkonditionierte Reaktion auslöst. Da der Lehrer mehrere Male seinen Befehl mit gleichzeitigem Klatschen abgibt (Substitution eines neutralen Reizes), vermag mit der Zeit das Klatschen allein die Reaktion der Schüler auszulösen. Das Klatschen ist somit zum konditionierten Reiz und das Ruhigwerden zur konditionierten Reaktion geworden.
Für wissenschaftlich wenig informierte Menschen ist es zumeist eine ernüchternde Erkenntnis, wenn sie zu akzeptieren genötigt sind, dass die Wissenschaft insgesamt mit Modellen arbeitet. Wenn z. B. Freud das Seelenleben des Menschen als „psychischen Apparat“, bestehend aus „Es“, „Ich“ und „Über-Ich“ beschreibt und u. a. das „Ich“ als „Rindenschicht“ des „Es“ auffasst, so sind dies alles Modelle, die frei aus dem menschlichen Denken heraus geschaffen sind und dazu dienen sollen, eine unendlich komplizierte und wohl letztlich unfassbare Wirklichkeit in den erkennenden Griff zu bekommen. Aber auch die Physik arbeitet mit Modellen, wenn sie z. B. die innerste Struktur und das eigentliche Wesen der Materie zu erfassen trachtet (Atom-Modelle). Beispiele liessen sich in allen Wissenschaftsbereichen machen.
Es gehört daher zum grundlegenden Wissen eines „gebildeten“ Menschen, dass er den Modell-Charakter einer jeden wissenschaftlichen Aussage stets im Auge behält und das modellhaft Beschriebene nicht für die Wirklichkeit selber hält. Ein Mensch, der dies tut, ist jenem zu vergleichen, der einen Baum mit dem oben beschriebenen Objektiv als Computer-Grafik abbildet und dann behauptet, ein Baum sei ein Wesen, das aus lauter gleich grossen und in sich gleichfarbigen Vierecken bestehe.
Es muss leider festgestellt werden, dass es viele „Denker“ gab (und noch gibt), denen die Modellhaftigkeit ihrer Aussagen nicht genügend klar war (und ist). Ein klassisches Beispiel ist Watson, der Begründer des Behaviorismus (siehe weiter unten), der – seinen Schriften nach zu schliessen – wirklich der Meinung war, es gebe im menschlichen Leben tatsächlich nichts anderes als das, was er durch die Einordnung in sein „Reiz-Reaktions-Modell“ zu erfassen vermochte.
Und schliesslich gilt es, eine weitere ernüchternde Feststellung zu machen: Die tragenden Elemente der rationalen Erkenntnis und der ihr angemessenen Sprache (das kann auch eine Kunstsprache wie etwa die Mathematik sein), nämlich die Begriffe, sind letztlich ebenfalls Modelle und darum nie deckungsgleich mit der konkreten Realität, auf die sie sich beziehen. Zwischen der rationalen Erkenntnis eines Sachverhalts und dem Sachverhalt selbst klafft immer eine Kluft, ja vielleicht ein Abgrund. So verstehen wir Fausts Verzweiflung, nachdem er doch so viel studiert hatte:
…und merke, dass wir nichts wissen können,
das möchte mir schier das Herz verbrennen.
Bleibt noch die Frage, wie man sich als erkenntnisbegieriger Mensch mit dieser Sachlage abfindet. Soweit ich sehe, gibt es zwei Wege:
- Die einen Menschen beschränken sich – bewusst oder unbewusst – auf ein einziges System von Modellen, das in sich möglichst stimmig ist, und ordnen dann nicht nur ihr ganzes Denken in dieses System ein, sondern leiten auch ihr Handeln davon ab. Obwohl ich weiss, dass es verschiedene Definitionen des Begriffs „Ideologie“ gibt, nehme ich mir die Freiheit heraus, dieses eben erwähnte Erkenntnis- und Handlungskonzept als „Ideologie“ zu bezeichnen. Es gibt unbeschränkt viele, und die meisten enden auf „-ismus“. Ideologien faszinieren zumeist dadurch, dass das grosse Lebensrätsel gelöst scheint, dass alle Denk-Rechnungen aufgehen und dass man mit letzter Sicherheit weiss, was für den Menschen und die ganze Welt gut ist. Überhaupt meine ich, dass Ideologien vor allem Sicherheit gewährleisten. Das erklärt auch, weshalb so viele Menschen diesen Weg beschreiten.
- Der zweite Weg wäre primär negativ zu beschreiben: als das bewusste Vermeiden einer Ideologie, und zwar aus der Erkenntnis heraus, dass das rationale Denken an sich – wegen seiner Verwiesenheit auf Modelle – dazu neigt, sich in Ideologien zu verhärten. Konkret bedeutet dies, die Welt von möglichst vielen verschiedenen Warten her zu betrachten, d. h. – bildlich ausgedrückt – möglichst viele Brillen zu erwerben und sie immer wieder zu wechseln. Das hat nichts mit Standpunktlosigkeit zu tun, sondern mit Weite. Dieser Weg führt dazu, dass die Menschen im Denken und Erkennen nicht – wie bei einer Ideologie – gleichgeschaltet sind, sondern eigenständig und originell werden. Er führt aber eben nicht – wie man bei oberflächlicher Betrachtung fürchten könnte – zur geistigen Isolation des Einzelnen, sondern zur geistigen Teilhabe am andern, da die Menschen, die sich um diesen Weg bemühen, das Denken und Erkennen der andern stets als eine weitere Möglichkeit der Betrachtungsweise zu würdigen wissen. Wer diesen zweiten Erkenntnis-Weg beschreitet, kann dies nicht tun ohne das Bewusstsein, dass die Differenzierung des Erkennens nie abbricht, dass er darum immer unterwegs ist und dass daher seine Weltbetrachtung stets als „der momentane Stand seines Irrtums“ betrachtet werden muss.
Plakativ liessen sich die beiden Erkenntnis-Standpunkte als „geschlossenes“ und „offenes“ Denken bezeichnen. Werden sie zu gesellschaftsbildenden Grundlagen, entstehen daraus – entsprechend – „geschlossene“ und „offene“ Gesellschaften.
2.2.3 Zurück zu Pawlow
Pawlow hat nachgewiesen, dass konditionierte Reiz-Reaktions-Verbindungen wieder verloren gehen, wenn der unkonditionierte Reiz nicht nach einer bestimmten Zeit wieder abgegeben wird. Diese Löschung der konditionierten Reiz-Reaktions-Verbindung bezeichnet man als Extinktion.
Das Modell der klassischen Konditionierung vermag insbesondere jene Lernprozesse gut zu erklären, die gar nicht erwünscht sind, sondern durch zufällige Reiz-Koppelung von selbst zustande kommen. So hat z. B. ein Schüler einmal beim Rechnen mit dem Rechenbuch einen sehr grossen Misserfolg erlebt, der ihm grosse Unlustgefühle verursachte. Das Misserfolgserlebnis ist somit der unkonditionierte Reiz und das Unlustgefühl die unkonditionierte Reaktion. Nun hatte er gleichzeitig das Rechenbuch in den Händen. Dieser neutrale Reiz wird durch die Koppelung mit dem Misserfolgserlebnis zum konditionierten Reiz und vermag demzufolge die Unlust-Reaktion (konditionierte Reaktion) selbständig auszulösen. Praktisch bedeutet dies: Jedesmal, wenn der Schüler das Rechenbuch zur Hand nimmt, löst dessen Anblick jene Unlustgefühle aus, die er seinerzeit beim Misserfolgserlebnis hatte.
Diese das schulische Lernen blockierende Konditionierung kann grundsätzlich auf zwei Arten beseitigt werden. Entweder gibt man dem Schüler ein anderes Lehrmittel (ich habe die Erfahrung gemacht, dass bereits der Austausch des Rechenbuchs durch ein zwar gleiches, aber neues Blockierungen lösen konnte), oder man sorgt bewusst dafür, dass sich mit dem Anblick des Lehrmittels positive Erlebnisse verbinden. In diesem Falle handelt es sich um Gegen-Konditionierung.
2.3 Die Lehre von John B. Watson (1878 – 1958): Behaviorismus
Watson gilt als der Begründer des klassischen Behaviorismus. Er war Zoologe und als solcher auch davon überzeugt, dass beim Menschen dieselben Gesetzmässigkeiten gelten wie beim Tier. Seine Lehre ist streng und konsequent materialistisch. Er hat sie erstmals 1913, dann umfassender 1930 in seinem Buch ‚Behaviorismus‘ ausformuliert. Bezeichnenderweise ist sein grundlegendes Werk 1968 erstmals in deutscher Sprache (bei Kiepenhauer und Witsch, Köln/Berlin) erschienen; man hielt offenbar damals seine Thesen für keineswegs überholt.
Watson setzte sich bewusst ab von der ‚Bewusstseins-Psychologie‘ Wilhelm Wundts (1. Leipziger Schule), und zwar sowohl hinsichtlich der Methode wie auch des Gegenstandes seiner Wissenschaft:
Von Wundts Methode liess er nur die Fremdbeobachtung und das Experiment gelten, lehnte aber die ‚Introspektion‘ (Selbstbeobachtung) konsequent und radikal ab. Diese Ablehnung steht in einem direkten logischen Zusammenhang mit der Ablehnung des Forschungs-Objekts der Bewusstseins-Psychologen. Wie es der Name sagt, interessierten sich diese für die Phänomene des Bewusstseins und definierten auch die Seele als Bewusstsein. Watson hingegen bestritt radikal die Existenz einer Seele – er musste sie daher auch nicht definieren – und behauptete auch, die Psychologie könne und dürfe sich nicht mit dem ‚Bewusstsein‘ befassen, sondern habe einzig und allein das beobachtbare Verhalten zu erforschen, vorherzusagen und zu kontrollieren.
Mit dem ‚Bewusstsein‘ hatte Watson allerdings seine liebe Mühe, denn es konnte ihm natürlich nicht entgehen, dass er eseigentlich selbst brauchte, um ein Buch zu schreiben, in welchem er es abzuschaffen gedachte. So sind denn seine Aussagen darüber sehr schillernd:
- Einmal hält er die Anwesenheit oder Abwesenheit des Bewusstseins für unbedeutend, da dadurch die Probleme des Verhaltens nicht im geringsten berührt würden. Das heisst: Es mag zwar so etwas geben wie ein Bewusstsein, aber wenn es der Fall sein sollte, so beeinflusst es keinesfalls das Verhalten, sondern begleitet dieses bloss so nebenher (so wie man etwa beim Arbeiten schwitzt, aber das Schwitzen keineswegs als die Verursachung des Arbeitens betrachtet werden darf).
- Dann verlangt er, dass die Psychologie die Illusion aufgebe, das Bewusstsein zum Gegenstand ihrer Beobachtungen machen zu können. Das bedeutet: Es mag ein Bewusstsein geben, aber wenn schon, dann hat die Psychologie als Natur-Wissenschaft keine Chance, darüber etwas Genaues auszusagen.
- Weiter bezeichnet er den Glauben an die Existenz eines Bewusstseins als ein Überbleibsel aus den Zeiten des Aberglaubens und der Magie, was klar einer Leugnung des Bewusstseins gleichkommt.
- Später vertritt er die Auffassung, die Verhaltenspsychologie gebe so viele Probleme auf, dass man keine Zeit habe, sich mit „dem Bewusstsein an sich“ zu befassen, was eigentlich doch recht arrogant ist.
- Und schliesslich nimmt er für sich als Wissenschafter in Anspruch, vom Bewusstsein unreflektiert – d. h. ohne darüber nachzudenken – Gebrauch machen zu dürfen, und verweist die Frage nach dem richtigen Gebrauch des Bewusstseins in den Kompetenzbereich der Philosophie.
Watson bezeichnete die bisherige Psychologie – in abwertendem Sinne – als ’subjektiv‘, was soviel wie ‚beliebig ersonnen‘ oder ‚unerheblich‘ heissen sollte, und hielt seinen Behaviorismus demgegenüber für eine ‚objektive‘ Psychologie, die sich in ihren Aussagen an unumstössliche, beobachtbare und messbare Tatsachen halte. Er forderte auch die Herauslösung der Psychologie aus dem grösseren Zusammenhang der ‚Geisteswissenschaften‘ (an der Universität vertreten durch die Philosophische Fakultät I) und ihre Eingliederung in die Naturwissenschaften (Philosophische Fakultät II). Seiner Ansicht nach sollte die Psychologie „mittelalterliche Vorstellungen“ wie ‚Bewusstsein‘, ‚Empfindung‘, ‚Wahrnehmung‘, ‚Vorstellung‘, ‚Wunsch‘, ‚Absicht‘, ‚Denken‘, ‚Gefühl‘, soweit sie subjektiv (d. h. als ‚inneres‘ Erlebnis) definiert sind, über Bord werfen. Von wissenschaftlicher Bedeutung sei einzig das beobachtbare Verhalten als Antwort auf bestimmte Reize. Darunter verstand er Veränderungen oder Bewegungen des Organismus, nämlich Muskeltätigkeit und Drüsenausscheidungen.
Watson ist einer der konsequentesten Vertreter eines materialistischen Menschenbildes. ‚Seele‘, ’seelisches Leben‘ oder ‚Geist‘ gibt es nicht. Der Mensch ist der Körper. Dieser wird verstanden als eine organische Maschine, wobei ‚organisch‘ bedeutet, dass diese Maschine millionenfach komplizierter ist als das, was Menschen bisher konstruiert haben. Menschliches Verhalten ist prinzipiell reaktiv, d. h. vollständig gesteuert durch unkonditionierte, grösstenteils aber konditionierte Reize. Der Mensch ist somit ein vollständiges Produkt der Umwelt und vollständig unfrei. So schreibt er 1930 wörtlich: „Gebt mir ein Dutzend gesunde, wohlgebildeter Kinder und meine eigene Umwelt, in der ich sie erziehe. Ich garantiere Ihnen, dass ich blindlings eines von ihnen auswähle und es zum Vertreter irgend eines Berufes erziehe, sei es Arzt, Richter, Künstler, Kaufmann oder auch Bettler, Dieb – ohne Rücksicht auf seine Talente, Neigungen, Fähigkeiten, Anlagen, Rasse oder Vorfahren.“ Wir haben hier das Dogma der vollständigen Machbarkeit des Menschen vor uns. Interessanterweise geht es einher mit der Lehre von der vollständigen Unfreiheit. Würde man z. B. Watson selber fragen, ob er sich nicht frei entschlossen habe, sein Buch zu schreiben, würde er antworten: Nein, die Reize der Umwelt haben so auf mich gewirkt, dass sie bei mir als Reaktion das Schreiben dieses Buches ausgelöst haben.
Wie bereits erwähnt, gibt es bei Watson auch keine grundsätzliche Trennung zwischen Mensch und Tier. Die Tiere (und damit auch der Mensch) bilden drei Gewohnheitssysteme aus, nämlich:
- das manuelle (Pestalozzi würde sagen: ‚Hand‘)
- das viszerale (in den ‚Eingeweiden‘ sitzende) oder emotionale (Pestalozzi würde sagen: ‚Herz‘)
- das verbale bzw. ‚Kehlkopfgewohnheiten‘ (Pestalozzi würde sagen: Kopf)
Der einzige Unterschied zwischen Mensch und Tier besteht darin, dass beim Menschen diese drei Gewohnheitssysteme stärker ausgebildet sind. Diese Gewohnheitssysteme sind zu verstehen als ein Ergebnis von Tausenden von Konditionierungen.
Die klassische Konditionierung ist das Herzstück von Watsons Theorie. Der Säugling ist mit einer beschränkten Anzahl ungelernter (unkonditionierter) Reiz-Reaktions-Verbindungen ausgestattet (Niesen, Schlucken, Schluckauf, Erektion des Penis, Greifreflex etc.) und alle andern Verhaltensweisen sind nach Watson diesen grundlegenden Reaktionsmustern aufkonditioniert. Komplexe Reaktionen (Tennisspielen, Sprechen, Denken) bezeichnet Watson als Gewohnheiten.
Zwar bestreitet Watson einen direkten Einfluss Pawlows auf seine eigene Lehre, doch basiert diese ganz klar auf dem Vorgang des bedingten Reflexes im Pawlow’schen Sinne. Ab etwa 1925 liess Watson nur noch die klassische Konditionierung als Lernmodell gelten, wobei er es allerdings insofern ausweitete, als er nicht bloss die Substitution eines Reizes anerkannte, sondern auch die Möglichkeit der Substitution einer Reaktion auf einen identischen Reiz als Erklärungsmodell von Lernprozessen einführte. So schreibt er: „Die Regel oder der Massstab, den der Behaviorist ständig vor Augen hat, lautet: Kann ich den Verhaltensausschnitt, den ich wahrnehme, in den Begriffen ‚Reiz und Reaktion‘ beschreiben.“ Deutlicher liesse sich der Ideologie-Charakter dieser Lehre („ständig vor Augen hält“) nicht ausdrücken. (Vgl. hierzu den oben gebotenen Exkurs unter 2.2.2.: Das Denken in Modellen.)
Interessant, wenn auch „abenteuerlich falsch“ (wie sich ein bedeutender Psychologe, dessen Name mir entfallen ist, ausdrückte) ist Watsons Sprach-Theorie. Sprache ist „in Wirklichkeit“ eine Manipulationsgewohnheit. Ausgangspunkt sind die ungelernten Stimmgeräusche, die das Kind bei der Geburt und später von sich gibt. Diese Töne sind ungelernte Reaktionen auf ungelernte innerorganische Reize. Der innerorganische Reiz wird gekoppelt mit dem Anblick eines Objekts oder einer Situation (konditionierter Reiz), und es erfolgt eine konditionierte Reaktion (Wort). „Wörter sind nur Substitute (Ersatz) für Objekte und Situationen“. „Nachdem die konditionierten Wortreaktionen teilweise aufgebaut sind, beginnt die Ausbildung von Ausdrucks- und Satzgewohnheiten.“ „Wörter können nicht nur andere Wörter, Ausdrücke und Sätze hervorrufen, sondern auch alle manuellen Tätigkeiten, wenn der Mensch entsprechend organisiert ist. Die Wörter, die Reaktionen hervorrufen, haben dabei die genau gleiche Funktion wie die Objekte, für welche die Wörter als Substitute dienen.“ „Sehr bald besitzt der Mensch ein verbales Substitut (einen wörtlichen Ersatz; AB) theoretisch für jedes Objekt in der Welt. Danach trägt er durch diese Organisation die Welt mit sich herum. Er kann diese Wort-Welt in der Abgeschlossenheit seines Zimmers oder in der Dunkelheit auf seinem Bette liegend manipulieren. … Wir tragen diese Welt als wirkliche Körperorganisationen mit uns herum, in der Muskel- und Drüsenorganisation unserer Kehle und unserer Brust.“ Beim Sprechen lösen die Muskelbewegungen der Sprachwerkzeuge als kinästhetische Reize (innerorganische Reize, die von den Muskelbewegungen ausgehen) die folgenden Wortreaktionen aus, womit der Redefluss gewährleistet ist. Wenn ich also sage: „Das ist Hans“, so löst der Reiz, der in meinen Sprechmuskeln durch das Aussprechen des Wortes „Das“ entsteht, als Reaktion das Aussprechen des Wortes „ist“ aus, und dieses wiederum regt das Aussprechen des Wortes „Hans“ als Reaktion an. Gefragt, weshalb denn nach „ist“ nicht „Fritz“ kommt, würde Watson sagen: Wäre der bisherige Reiz-Reaktions-Ablauf („Das ist“) mit dem Anblick von Fritz gekoppelt, so würde dieser Reiz dann das Aussprechen von „Fritz“ auslösen.
Auf gleichem Niveau liegt Watsons Theorie des Denkens. „Der Behaviorist stellt eine naturwissenschaftliche Theorie des Denkens vor, die das Denken genau so einfach und zu einem Teil biologischer Prozesse werden lässt wie das Tennisspielen.“ Denken ist jenes Wortverhalten, das lautlos vor sich geht (Mit-sich-selbst-Flüstern, Kehlkopfgewohnheiten). Die Muskelgewohnheiten, die beim wahrnehmbaren Sprechen gelernt werden, sind für das innere Sprechen (Denken) verantwortlich. Gegner Watsons haben diese Theorie als „Muskel-Zuckismus“ verspottet.
Natürlich musste Watson sich mit vielerlei Kritik auseinandersetzen. So hielt man ihm vor, Wörter würden doch nicht einfach als Lautgebilde ausgestossen, sondern hätten eine Bedeutung. Watsons Entgegnung ist typisch für das ideologische Denken: „Die behavioristische Theorie des Denkens muss nach ihren eigenen Voraussetzungen beurteilt werden. Die Voraussetzungen des Behavioristen enthalten jedoch keine Aussage über ‚Bedeutung‘.“
Gefühle (emotionale Reaktionen) sind nach Watson „Abweichungen von normalen Reaktionen“, nämlich verlangsamte, blockierte, negative, nicht sanktionierte (abgelehnte), gehemmte Reaktionen. Bei diesen Reaktionen haben dann nicht die Muskel-, sondern die viszeralen und die Drüsenfunktionen die Oberhand. Watson hat herausgefunden, dass bei einem Neugeborenen drei verschiedene Gefühlsreaktionen durch drei verschiedene Gruppen von Reizen hervorgerufen werden können (unkonditionierte Reize und unkonditionierte Reaktionen):
- Furcht durch Geräusche und Halteverlust.
- Wut durch Behinderung der Bewegung.
- Liebe durch Streicheln, Kitzeln, Schaukeln, Tätscheln.
Alle übrigen Gefühlsreaktionen sind nach Watson konditionierte Reaktionen auf konditionierte Reize.
2.4 Lernen durch Versuch und Irrtum
2.4.1 Die Katzen von Edward Thorndike
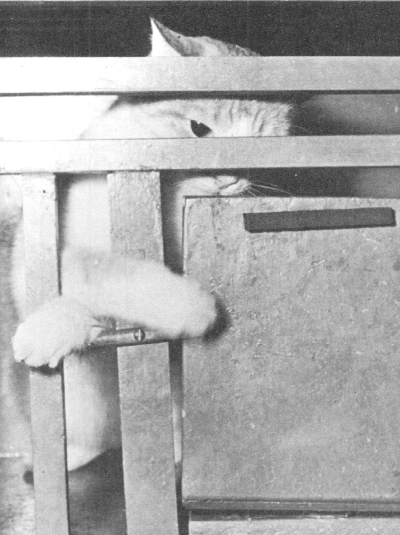
Der amerikanische Behaviorist Edward L. Thorndike (1874 – 1949) experimentierte mit Katzen. Er sperrte sie in einen Käfig („Problemkäfig“), der von innen durch einen Druck an einen Hebel geöffnet werden konnte. Solange die Katze keinen Hunger hatte, fand sie sich mit der Situation ab und schlief. Hungrig geworden, versuchte sie sich zu befreien, um an das ausserhalb des Käfigs liegende Futter zu kommen. Dabei geschah es, dass sie rein zufällig gegen den Hebel stiess und damit den Öffnungsmechanismus betätigte. Es zeigte sich nun im Verlaufe der weiteren Versuche, dass die Zeit zwischen dem Beginn der Befreiungsversuche und dem Hebeldruck immer kleiner wurde, bis die Katze schliesslich direkt auf den Hebel zuging. Sie hatte also gelernt, sich durch einen Hebeldruck aus dem Käfig zu befreien.
Dieses Lernen bezeichnet man als „Lernen durch Versuch und Irrtum (trial and error)“. Grundvoraussetzung ist, dass das Versuchstier überhaupt zum Äussern irgendwelcher Reaktionen motiviert ist. Die Katze begann erst mit dem Lernprozess, wenn sie Hunger verspürte. Mit andern Worten: Das Lernen setzt das Erleben einer Bedürfnisspannung voraus. Ziel des Lernens ist es, diese Bedürfnisspannung abzubauen. Die Katze machte zuerst ziellose Versuche, bis einer zufällig dazu führte, dass sich die Türe öffnete. Die Veränderung der Situation wird der Katze über die Sinne zurückgemeldet (Feedback), und sie wertet die Befreiung im Hinblick auf die Bedürfnisspannung als Erfolg. Der Erfolg bewirkt die Reduktion der Bedürfnisspannung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier in ähnlichen Situationen gleich reagiert. Der Lerneffekt ist somit eine Frucht des Erfolgs.
Diesem Lernmodell liegt eine allgemeinere Modellvorstellung aus der Physiologie zu Grunde, nämlich das Modell der Homöostase. Es besagt, dass grundsätzlich jeder Organismus stets einen Zustand des Gleichgewichts anstrebt, dass aber dieses Gleichgewicht fortwährend durch Reize gestört wird. Das Erlebnis des gestörten Gleichgewichts bewirkt dann die Reaktion, welche dem Zweck dient, das Gleichgewicht im Rahmen der neuen Situation wieder herzustellen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Anpassung.
Thorndikes Lernmodell lässt sich auch für die Beschreibung des menschlichen Lernens verwenden. So stellen wir etwa beim Kleinkind fest, dass es grundlegende Verhaltensweisen wie etwa das Gehen oder das Bauen eines Turms mit Klötzen durch Versuch und Irrtum lernt. Wenn ein Kleinkind einen Klotz auf den andern stellt, so hat es vorerst noch keine Einsicht in irgendwelche statischen Gesetze. Es legt den einen Klotz zuerst so auf den andern, dass sein Schwerpunkt ausserhalb der Kante der Unterlage zu liegen kommt und der Klotz daher abkippt. Legt es ihn zufällig richtig auf den unteren, so bewirkt dieser Erfolg, dass es künftig weniger Fehler macht.
2.4.2 Exkurs: Didaktische Überlegungen
Das Lernen durch Versuch und Irrtum kann auch beim schulischen Lernen eine Rolle spielen oder gezielt eingesetzt werden, z. B. beim Erlernen des Maschinen-Schreibens. Solange der Schüler blind schreibt und einfach auf die Vorlage blickt, kann er freilich nicht feststellen, ob seine Reaktion die richtige war; seine Fehler kommen erst zu spät, nämlich bei der Korrektur, zum Vorschein und bewirken keinen direkten Lerneffekt im Sinne des vorliegenden Lernmodells. Ganz anders ist dies, wenn er am Bildschirm den freien Gebrauch der Tastatur übt. Der Bildschirm meldet ihm nämlich jedesmal gleich nach der erfolgten Reaktion (Tastendruck) den Erfolg bzw. Misserfolg zurück (Feedback). Je länger er schreibt, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Reaktionen, bis er schliesslich die Tastatur korrekt bedienen kann.
Aus Thorndikes Lernmodell geht auch hervor, dass Lernen grundsätzlich motiviert sein muss. Wenn der Schüler kein Bedürfnis verspürt, etwas zu lernen, wird es in unsern Schulen dann die Sache des Lehrers, durch irgendwelche künstliche Mittel (z. B. Drohung mit Noten) ersatzweise eine gewisse Bedürfnisspannung zu erzeugen. Gelingt ihm auch dies nicht, ist alle Mühe umsonst.
Ferner können wir dem Trial-and-error-Lernen entnehmen, dass der Lernerfolg für das weitere Lernen von ausschlaggebender Bedeutung ist. Von dieser Warte her liesse sich sagen: Ein guter Lehrer hat u.a. die Fähigkeit, den Lernprozess so zu organisieren, dass die Schüler zum Erfolg kommen können. Praktisch bedeutet dies, die Lernansprüche so zu dosieren, dass keine Überforderungen entstehen, da dann die Schüler in ihren Anstrengungen aufgeben. Aber auch Unterforderungen müssen vermieden werden, da die Schüler das Lösen zu leichter Aufgaben nicht mehr als Erfolg werten.
Thorndike hat auch durchaus zu recht betont, dass ein gesicherter Lernerfolg eben nur durch Wiederholung, d.h. durch stetige Übung erzielt werden kann (was man selbstverständlich lange vor Thorndike wusste). Dabei ist freilich zu beachten, dass ‚Übung‘ durchaus Verschiedenes bedeuten kann. So ist es etwas anderes, ob ein Schüler den Felgaufschwung oder das schriftliche Teilen übt. Weiter unten wird im Zusammenhang mit der Gestalt-Psychologie vom ‚Lernen durch Einsicht‘ die Rede sein. Beim Menschen ist zumeist auch beim Lernen durch Versuch und Irrtum ‚Einsicht‘ vorhanden, und wir werden sehen, dass diese in vielen Lernsituationen das Übungsbedürfnis beschränkt oder gar ganz überflüssig macht.
Schliesslich bringt uns das Thorndike’sche Modell auf den Gedanken, dass man im allgemeinen Gelerntes besser behält, wenn man es durch eigenes Probieren selbst herausgefunden hat. Die Didaktik betont daher immer wieder den Wert des entdeckenden Lernens. So hat der Pädagoge und Philosoph Martin Wagenschein im Rahmen seines ‚exemplarischen Lernens‘ dem Warten-Können, bis der Schüler durch eigene Aktivität zur richtigen Lösung kommt, sehr grosse Bedeutung beigemessen. Das klassische Anwendungsgebiet dieser Lernweise, in welcher die Schüler im Gespräch mögliche Lösungswege vorschlagen und miteinander diskutieren, sind Mathematik, Physik und Chemie (Wagenschein war Physiker), denn hier lassen sich die Gesetzmässigkeiten durch eigenes Beobachten und Denken erarbeiten. So lässt sich z. B. durch eigenes Nachdenken herausbringen, woher der Jahreszeiten-Rhythmus kommt oder wie man zwei Brüche miteinander multipliziert. Aufgabe des Lehrers ist es dann eben, die Schüler in ihrem Denken zu begleiten, damit sie selbst die Lösung finden. Dies geschieht vor allem dadurch, dass man ihre Hypothesen (Vermutungen) mit ihnen durchtestet und die Lösungsvorschläge bis zu jenem Punkt konsequent weiterdenken lässt, bis sie sich eindeutig als wahr oder falsch erweisen.
Die Verhältnisse liegen etwas anders z. B. in der Geschichte oder in der Biologie. Mag unsere Denkfähigkeit noch so gross sein: Ob es in Australien Kängurus gibt oder am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Hitler fehlschlug, ist durch blosses Nachdenken nicht herauszubringen. Trotzdem lassen sich natürlich – in einem erweiterten Sinne – auch in allen übrigen Fächern entdeckendes Lernen, eigenes Probieren im Sinne von Versuch und Irrtum, anwenden.
Es wäre indessen nicht sinnvoll, nun den ganzen Unterricht nach diesem Lernprinzip gestalten zu wollen. So würde ich beispielsweise keinesfalls den Gebrauch von Werkzeugen im Werken oder die richtige Technik beim Spielen eines Musikinstrumentes durch Versuch und Irrtum lernen lassen, weil der Schüler irgendwelche private Techniken in seinem Anfangszustand noch als erfolgreich erlebt, die sich später als sehr hemmend herausstellen. Gerade der Gebrauch von Werkzeugen oder die Technik des Instrumentalspiels sind über Jahrhunderte hinweg durch Könner erprobt und verfeinert worden, weshalb es nicht die Aufgabe eines Anfängers sein kann, hier seine „Kreativität“ unter Beweis zu stellen. Darum ist im handwerklichen Bereich – soweit es um die richtige Technik geht – grundsätzlich das Nachahmungs-Lernen angezeigt, und die Kreativität des Schülers vermag sich dann – weil er eine richtige Technik erworben hat – wirklich dort zu zeigen, wo sie hingehört, nämlich im Bereich der inhaltlichen Gestaltung.
2.5 Operante Konditionierung
2.5.1 Die Tauben und Ratten von B.F. Skinner

B.F. Skinner (1904 – 1990) setzte bei seinen Überlegungen bei Thorndikes Erkenntnis an, dass der Erfolg das zuvor geäusserte Verhalten bekräftigt bzw. verstärkt. Im ganzen Denken Skinners nimmt der Vorgang des Verstärkens (Bekräftigens) die zentrale Stellung ein. Man kann daher die Skinner’sche Lernweise auch als ‚Bekräftigungs-Lernen‘ bezeichnen.
Zwischen Thorndikes Lernen durch Versuch und Irrtum und dem Skinnerschen Bekräftigungslernen gibt es allerdings einen fundamentalen Unterschied: Im Thorndike’schen Lernmodell ergeben sich die Verstärker aus der Sache selbst. Wenn ein Kind aus seinen Klötzen einen Turm bauen will, so muss ihm niemand sagen oder sonstwie zu verstehen geben, dass dies ein Erfolg ist.
Es vermag die neue Situation als Erfolg zu werten, weil sie mit seiner eigenen Zielvorstellung übereinstimmt. Skinner ging nun über diese Verstärkung durch die Sache selbst einen weiteren Schritt hinaus, indem er bei Ratten und Tauben beliebige Verhaltensweisen durch gezielte Abgabe äusserer Verstärker aufbaute. Etwas vereinfacht liesse sich sagen: Skinner führte in seine Lerntheorie den Lehrer ein. Konditionierungen im Pawlow’schen Sinne sind ja durchaus möglich, ohne dass eine Drittperson mitwirkt. Dasselbe gilt für das Lernen durch Versuch und Irrtum. Was hingegen die Versuchstiere Skinners lernten – z. B. mit den Flügeln Ping-Pong spielen –, setzte stets einen Lern-Plan bei einem konditionierenden Menschen voraus.
Skinner brachte unter anderem einer Taube bei, auf sieben zu zählen. Klopfte sie mit dem Schnabel gegen die Wand, liess er ein Futterkorn in den Napf gleiten. Für die Taube war natürlich das Klopfen gegen die Wand an sich kein erfolgreiches Verhalten, und es besteht auch kein logischer Zusammenhang zwischen dieser Verhaltensweise und der Futterabgabe. Trotzdem verknüpfte (assoziierte) die Taube ihr Verhalten mit dem positiven Erleben des Futterempfangs. Nun ging es darum, die Taube an einen bestimmten Punkt der Wand (ein Metallplättchen) klopfen zu lassen. Skinner belohnte die Taube daher immer dann mit einem Futterkorn, wenn sie sich bei ihrem Klopfen in die gewünschte Richtung bewegte, bis sie schliesslich beim Metallplättchen ankam. Skinner wollte also nicht warten, bis die Taube zufällig auf das Metallplättchen klopfte, sondern verstärkte jede zufällig geäusserte Reaktion der Taube in die von ihm gewünschte Richtung. Diese Methode bezeichnet man als graduelle Annäherung. Nun ging es darum, der Taube das „Zählen“ beizubringen. Skinner verweigerte daher beim nächsten Klopfen auf die Metallplatte die Futterabgabe; die Taube klopfte nach – und siehe da, das Korn kam wieder. Sehr bald klopfte die Taube von sich aus gleich zweimal, um die erwünschte Futterabgabe zu bewirken (man nennt daher die so erzielten Reaktionen „Wirk-Reaktionen“). Im nächsten Schritt verweigerte Skinner die Futterabgabe wieder, und die Taube klopfte wieder nach. So gelang es durch systematische Verstärkung, sie zum dreimaligen, später zum vier-, fünf-, sechs- und siebenmaligen Klopfen zu konditionieren.
Im Gegensatz zur „klassischen“ Konditionierung Pawlows bezeichnet man das Skinner’sche Lernmodell als operante (operative, instrumentale) Konditionierung. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass nicht – wie bei der klassischen Konditionierung – Reize miteinander gekoppelt, sondern durch die systematische Abgabe von Verstärkern neue Reaktionen aufgebaut werden. Bei genauem Hinsehen zeigt sich nämlich, dass ja mit der klassischen Konditionierung gar keine neuen Reaktionen erlernt werden – Pawlows Hund konnte immer schon speicheln, und auch Watsons Knabe konnte schon vor der Angst-Konditionierung schreien –, sondern dass lediglich ‚alte‘ Reaktionen mit ’neuen‘ Reizen verbunden werden. Ganz anders bei der operanten Konditionierung: Hier entsteht wesentlich neues Verhalten, das aus vielen kleinen, einfachsten Elementen systematisch aufgebaut wird.
Betrachten wir einen weiteren Unterschied zwischen dem operanten und dem klassischen Konditionieren: Bei der klassischen Konditionierung geht konsequent ein Reiz einer Reaktion voraus. Das heisst: Es besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Reiz (Ursache) und der Reaktion (Wirkung). Die operante Konditionierung beruht aber auf dem Bestreben von Tier und Mensch, durch eine vorausgehende Reaktion einen in der Zukunft liegenden Reiz herbeizuführen (zu bewirken). Die Reaktion ist somit das Mittel, um den Zweck – nämlich den Verstärker – zu erhalten. Das Verhalten (die Reaktion) ist somit nicht kausal, sondern final determiniert (bestimmt). Oder anders ausgedrückt: Bei der klassischen Konditionierung kommt zuerst der Stimulus, bei der operanten zuerst die Reaktion. Wir drücken diese Unterscheidung abgekürzt dadurch aus, dass wir entweder vom „Modell S-R“ (Pawlow, Watson) oder vom Modell „R-S“ (Skinner) sprechen.
Nun kann man natürlich mit Recht behaupten, dass auch im Skinner’schen Modell die Reaktion nicht aus heiterem Himmel fällt, sondern ebenfalls auf vorausgehenden Ursachen beruht. Skinner würde dem zustimmen, aber er würde entgegnen, dass die vielen Reize, die in einem Augenblick auf einen Organismus einwirken, zu unterschiedlichsten Reaktionen führen können und dass die jeweils bevorzugte Reaktion eben durch den in der Zukunft liegenden Reiz ausgelöst wird. Ein Beispiel: Ich stelle als Lehrer fest, dass es im Schulzimmer immer dunkler wird. Gleichzeitig beginne ich zu frösteln, und die Schüler stören mich durch ihre Unruhe. Zudem spielt im Nebenraum noch jemand Klavier und lenkt damit meine Schüler zusätzlich ab. Schliesslich geht es gegen Abend, und ich bin nicht bloss müde, sondern ich habe auch noch ziemlich stark Hunger. Aufgrund dieser zahlreichen Reize wären nun die verschiedensten Reaktionen möglich. Wenn ich nun aber zum Lichtschalter gehe und ihn kippe, so erklärt sich diese Verhaltensweise nicht bloss durch die zunehmende Dunkelheit (ich könnte ja auch mit Unterrichten aufhören) und schon gar nicht aufgrund der übrigen Reize, sondern nur aus dem von mir erwarteten Reiz, dass es jetzt heller wird. Das Einwirken mehrerer Ursachen in eine Reiz-Reaktions-Situation bezeichnet Skinner als multiple Kausation (mehrfache Verursachung).
Wie eingangs erwähnt, steht im Zentrum der operanten Konditionierung das Verstärken. Skinner und seine Schüler haben sich daher sehr eingehend dem Problem des Verstärkens gewidmet. Inhaltlich lassen sich positive von negativen Verstärkern unterscheiden:
Eine Verstärkung ist positiv, wenn sie Verhaltensweisen bekräftigt, die darauf abzielen, die Verstärkung erneut zu erhalten. Beispiel: Ich lobe ein kleines Kind, wenn es das Messer richtig hält. Wenn das Kind nächstes Mal das Messer wieder richtig hält, möchte es eigentlich mein Lob erhalten.
Eine Verstärkung ist negativ, wenn sie eine Verhaltensweise bekräftigt, die darauf abzielt, eben diese Verstärkung zu vermeiden. Beispiel: Ich tadle ein Kind, wenn es flucht. Damit bekräftige ich das Unterbleiben des Fluchens, welches – vom Kinde aus gesehen – bezweckt, keinen Tadel zu erhalten.
Wie später gezeigt wird, setzte Skinner das Erleben positiver und negativer Verstärker an die Stelle der fundamentalen moralischen Unterscheidung von Gut und Böse: gut sind positive, böse negative Verstärker.
Versuche haben gezeigt, dass positive Verstärker auf die Dauer wirksamer sind als negative. Praktisch bedeutet dies, dass sich der Lehrer beim Lehren (und auch bei der Erziehung) in erster Linie auf das erwünschte Verhalten des Schülers konzentrieren und dieses verstärken soll und das unerwünschte Verhalten – soweit sich dies machen lässt – ignoriert. Es ist hier anzumerken, dass diese Erkenntnisse natürlich nicht neu sind. Die Erziehung hat seit eh und je mit Belohnungen und Bestrafungen gearbeitet, und erfahrene Erzieher wussten immer schon, dass positive Lenkungsmassnahmen wirksamer sind als negative.
Skinner hat mit seinen Ratten und Tauben viele Versuche gemacht und dabei jene Arten von Verstärkungen herausgefunden, welche am sichersten zum Erfolg führen. Dabei hat er – neben der bereits erwähnten Unterscheidung von positiven und negativen Verstärkern – unterschieden zwischen der Verstärkung des erwünschten Verhaltens nach einer bestimmten Zeit und der Verstärkung nach einer bestimmten Anzahl geäusserter Verhaltensweisen. Im allgemeinen war die Verstärkung nach dem zweitgenannten Prinzip („Reaktionsquoten-Verstärkung“) wirksamer als die Verstärkung nach vorgefassten Zeitabschnitten („Zeitintervall-Verstärkung“). Beispiele aus der Schulpraxis: Ein Lehrer, der etwa jeden zweiten oder dritten Aufsatz benotet, die übrigen aber nicht, wendet die Reaktionsquoten-Verstärkung an. Demgegenüber ist die Abgabe von Semester-Zeugnissen als Zeitintervall-Verstärkung zu betrachten.
Skinner hat dann auch untersucht, ob die regelmässige oder unregelmässige (intermittierende) Abgabe von Verstärkern ein erwünschtes Verhalten sicherer festige. Es hat sich gezeigt, dass unregelmässiges Verstärken wirksamer ist.
Das Konzept des ‚Verstärkens‘ hat breit Eingang in die Psychologie gefunden, weshalb viele den Begriff verwenden, die sich nicht bloss auf Skinner stützen. Dazu gehört die Wiener Psychologin Lotte Schenk-Danzinger; sie teilt die Verstärker einerseits ein in positive und negative, andererseits in primäre, materielle, symbolische und soziale.
| Beispiele: | Positive Verstärker | Negative Verstärker |
| primäre Verstärker: | Nahrung, Freizeit, Zärtlichkeit | Freiheitsentzug, Nahrungsentzug, Körperstrafe |
| materielle Verstärker: | Spielzeug, Geld | Entzug von Spielsachen, Geldbusse |
| symbolische Verstärker: | Fleisszettel, gute Noten | Strafpunkte, schlechte Noten |
| soziale Verstärker: | Lob, Anerkennung, Zuwendung | Tadel, Schmähung, Blossstellung, Verletzung |
Die praktische Erfahrung zeigt, dass bei den primären, materiellen und symbolischen Verstärkern immer die sozialen mitschwingen und letztlich auch für den Effekt ausschlaggebend sind. So ist z. B. der Schmerz, den ein Schüler etwa durch den Aufprall eines Balls an seinem Körper beim Fussballspiel erduldet, möglicherweise wesentlich grösser als jener bei einer körperlichen Züchtigung. Es kann also nicht der Schmerz an sich sein, was die körperliche Züchtigung so schwerwiegend macht, sondern es ist die darin erlebte Missachtung und die Blossstellung vor den andern, was zählt, d.h. eben der soziale (negative) Verstärker. Dasselbe gilt, wenn der Lehrer einem Erstklässler für eine schön geschriebene Arbeit ein Fleiss-Bildchen gibt: Nicht das Bildchen (der symbolische Verstärker) wirkt, sondern die Zuwendung und Anerkennung des Lehrers.
Behavioristisch eingestellte Psychotherapeuten (d.h. Psychologen, die nicht bloss theoretisieren oder forschen, sondern ihre Erkenntnisse zur Heilung von Verhaltensstörungen einsetzen wollen) haben auf der Grundlage der Skinner’schen Verstärkungstechnik eine Therapiemethode entwickelt, die Verhaltens-Therapie. Diese sucht ganz bewusst nicht (wie es die Tiefenpsychologen tun) nach Ursachen der Störung, die im Innern (im Unbewussten, in vergangenen, verdrängten Erlebnissen) liegen, sondern behandelt gezielt das sichtbare Symptom. Wenn z. B. ein Kind an einer Phobie (z. B. völlig unbegreifliche und übertriebene Angst vor Pferden) leidet, so betrachtet die Verhaltenstherapie dies als ein Fehlverhalten, das durch richtige (systematische) Konditionierung geändert werden kann. Die grundlegende Technik ist die graduelle Annäherung: Jeder Schritt in die vom Therapeuten erwünschte Richtung (z. B. die Fähigkeit, ein Bild eines Pferdes zu berühren) wird von diesem belohnt (bekräftigt) durch irgendwelche Verstärker. Tiefenpsychologisch eingestellte Psychotherapeuten werfen dieser Methode vor, das eigentliche Problem werde durch sie gar nicht gelöst und diese Symptombehandlung führe einfach zu einer Symptomverschiebung. Verhaltenstherapeuten lassen aber diesen Einwand nicht gelten, weil sie gar nicht an ein Unbewusstes im Sinne der Tiefenpsychologen glauben und das Problem einzig auf der Ebene des sichtbaren Verhaltens sehen. Für sie ist das Problem gelöst, sobald sich das Verhalten geändert hat.
2.5.2 Grenzen des Lernmodells ‚operante Konditionierung‘
Fassen wir die bisherigen Ergebnisse zusammen, liesse sich sagen: Am wirksamsten sind positive, soziale, intermittierende Reaktionsquoten-Verstärkungen.
Der behavioristisch eingestellte Erzieher würde diese allgemeine Aussage wohl direkt in sein erzieherisches Verhalten einbeziehen. Skinner selbst spricht im Zusammenhang mit dem systematischen Aufbau erwünschten Verhaltens von einer ‚Verhaltens-Technologie‘; das Verstärken wäre demnach in seinem Sinne das Mittel zum berechneten Steuern des Verhaltens. Obwohl natürlich die Erziehung immer schon mit positiven und negativen Verstärkern (Belohnung, Bestrafung, Lob, Tadel etc.) gearbeitet hat, halte ich jedoch die systematische Anwendung der Skinner’schen Lern-Technologie aus verschiedenen Gründen für fragwürdig:
Erstens ist zu beachten, dass Skinner seine Versuche an Tieren und nicht an Menschen anstellte und dass darum deren Ergebnisse nur sehr bedingt auf den Menschen übertragen werden dürfen.
Zweitens zielte Skinner mit seinen Versuchen auf allgemeingültige Aussagen und Gesetzmässigkeiten hin; die Erziehungspraxis zeigt hingegen, dass eine Massnahme nicht unabhängig von den konkret beteiligten Menschen beurteilt werden darf. So kann sich das, was sich Skinner als allgemeingültig aufgedrängt hat, beim einen Kind positiv, beim andern negativ auswirken, und umgekehrt kann der eine Erzieher mit der Anwendung einer behavioristischen Empfehlung Erfolg haben, wogegen ein anderer damit nichts erreicht. Für diese unterschiedlichen Ergebnisse sind Sachverhalte massgebend, die – mindestens teilweise – ausserhalb der Skinner’schen Versuchsanordnungen liegen.
Drittens dürfte meiner Ansicht nach das Verstärken nicht das Ergebnis einer kühlen Berechnung sein, weil damit der Schüler im Bewusstsein des Lehrers zum manipulierbaren Objekt absinkt. Die Verstärkungen sollten vielmehr einem echten Bedürfnis des Lehrers entspringen, da er in einer annehmenden Beziehung mit den Schülern lebt. Der erfahrene Lehrer verstärkt daher das erwünschte Verhalten der Schüler ganz automatisch, indem er seiner Freude über den Erfolg Ausdruck gibt, lobt, Anerkennung ausspricht usf. Das schafft ein positives Arbeitsklima und ermutigt die Schüler, sich anzustrengen und gute Leistungen zu erbringen. Es liesse sich sagen: Das ganze Verhalten des Erziehers sollte so sein, dass es positiv verstärkend wirkt, ohne dass der Erzieher bewusst daran denkt.
Zum Schluss möchte ich auch bei diesem Lernmodell an seine Grenzen erinnern. Überall, wo Einsicht mit im Spiel ist, ist es nämlich letztlich nicht die Verstärkung, welche zum Lernerfolg führt, sondern eben die Möglichkeit der Einsicht. Wenn jemand nicht fähig ist, die Integralrechnung zu begreifen, so kann ich verstärken so viel ich will: es nützt alles nichts. Und wenn ich es mit Ach und Krach fertig brachte, indem ich jeden kleinen Erkenntnisschritt positiv verstärkte, so habe ich mit dieser Massnahme durchaus nicht den eigentlichen Lerneffekt erzielt (der beruhte nämlich immer auf Einsicht), sondern ich habe lediglich die Motivation aufrechterhalten, damit der Schüler das Lernen nicht abbrach. Zwar erhebt Skinner den Anspruch, mit der Methode der graduellen Annäherung neues Verhalten aufbauen zu können, und das mag auch zutreffen bei der Taube, die Ping-Pong spielen lernt. Aber der Mensch lernt viel mehr durch Nachahmung und Einsicht (siehe später), und die Verstärkung hat dann den Effekt, dass er überhaupt lernt. Überspitzt formuliert, liesse sich sagen: Das Skinner’sche Modell der operanten Konditionierung ist eigentlich kein Lern-Modell, sondern ein Motivations-Modell. All das, was ich nämlich im täglichen Umgang mit dem Kind verstärke, kann es ja schon (sonst könnte ich es ja nicht verstärken); ich möchte durch mein Verstärken lediglich, dass das Kind das von mir erwünschte Verhalten weiterhin an den Tag legt. Und das heisst dann eben: Mit der Verstärkung motiviere ich das Kind zum erwünschten Verhalten, ich sorge dafür, dass es die bereits geäusserte Verhaltensweise künftig gewohnheitsmässig tut.
2.5.3 Exkurs: Skinner als Philosoph
Skinner vertritt die materialistisch fundierte behavioristische Theorie mit grosser Konsequenz. In seinen Schriften befasst er sich nicht nur mit lernpsychologischen Problemen, sondern widmet sich auch philosophischen und sozialpolitischen Fragen. In seinem Buch „Jenseits von Freiheit und Würde“ (Rowohlt, 1973) wendet er sich vehement gegen die „vorwissenschaftliche Vorstellung“ des autonomen (freien, selbstverantwortlichen, geistigen) Menschen und fordert leidenschaftlich dessen „Abschaffung“ und die Kontrolle des Menschen durch eine Verhaltenstechnologie der Wissenschaft. In seiner Utopie „Futurum Zwei“ (Christian Wegner Verlag, Reinbeck, 1970; englisches Original: „Walden Two“, 1948) entwirft er das Bild einer erdachten Gesellschaft, in welcher die Menschen glücklich sind, weil sie durch die Wissenschaft von Geburt her systematisch richtig konditioniert wurden. Hier einige Zitate aus ‚Jenseits von Freiheit und Würde‘:
„Was im Begriff ist, abgeschafft zu werden, ist der ‚autonome Mensch‘ – der innere Mensch, der Homunkulus, der besitzergreifende Dämon, der Mensch, der von der Literatur der Freiheit und der Würde verteidigt wird. Seine Abschaffung ist seit langem überfällig. Der ‚autonome Mensch‘ ist ein Mittel, dessen wir uns bei der Erklärung jener Dinge bedienen, die wir nicht anders erklären können. Er ist ein Produkt unserer Unwissenheit, und während unser Wissen wächst, löst sich die Substanz, aus der er gemacht ist, immer mehr in Nichts auf. Die Wissenschaft entmenschlicht den Menschen nicht, sie ‚dehomunkulisiert‘ ihn, und es bleibt ihr nichts anderes übrig, wenn sie der Abschaffung der menschlichen Spezies vorbeugen will: Wir können froh sein, wenn wir uns von diesem Menschen im Menschen befreit haben. Nur wenn wir ihn seiner Rechte entsetzen, können wir uns den echten Ursachen menschlichen Verhaltens zuwenden. Und nur dann können wir vom Abgeleiteten zum Beobachteten gelangen, vom Wunderbaren zum Natürlichen, vom Unzulänglichen zum Beeinflussbaren. – Es wird oft behauptet, dass wir, wenn wir das tun, den Menschen, der überlebt, als blosses Tier behandeln müssten. „Tier“ ist hier ein abwertender Begriff, aber nur, weil der Begriff Mensch fälschlicherweise aufgewertet worden ist. (Anmerkung AB: Mit dem Ausdruck „fälschlicherweise aufgewertet“ verrät sich Skinner, denn er gibt, wohl ohne es zu merken, zu, dass die Vorstellung eines geistigen, autonomen Menschen offenbar doch die ‚höhere‘ als die seinige ist.) Krutch argumentiert, dass, während die traditionelle Anschauung Hamlets Ausruf ‚Wie ein Gott!‘ unterstütze, Pawlow, der Verhaltenswissenschafter, dieses Zitat in den Ausspruch ‚Wie ein Hund!‘ umformuliert habe. Doch das war ein Schritt voran. Ein Gott ist das archetypische Muster einer Fiktion, mit der etwas erklärt werden soll, eines wunderwirkenden Geistes, des Metaphysischen. Der Mensch ist wesentlich mehr als ein Hund, doch ebenso wie ein Hund ist auch er durch wissenschaftliche Analyse erfassbar.“ (S. 205 f.).
„Zwei Grundzüge des autonomen Menschen sind besonders störend. Der überlieferten Meinung nach ist eine Person frei. Sie ist frei in dem Sinne, als ihr Verhalten nicht verursacht ist. Daher kann sie für ihr Tun verantwortlich gemacht und kann sie mit Recht bestraft werden, wenn sie Unrecht tut. Diese Ansicht muss, zusammen mit den damit verbundenen Praktiken, neu überprüft (d.h. für Skinner: abgelehnt) werden.“ (S. 26. f.). „Eine wissenschaftliche Analyse überträgt sowohl die Verantwortlichkeit als auch die Leistung auf die Umwelt.“ (S. 32.). „Es ist die Umwelt, die für das unzulässige Verhalten ‚verantwortlich‘ ist, und es ist die Umwelt und nicht eine Eigenschaft der Einzelperson, die geändert werden muss.“ (S. 80).
„Die einzigen guten Dinge, die es gibt, sind positive Verstärker, und die einzigen schlechten Dinge negative Verstärker.“ (S. 112)
„Ein kleiner Teil des Universums ist umschlossen mit menschlicher Haut. Es wäre unsinnig, die Existenz dieser privaten Welt ableugnen zu wollen, aber genauso unsinnig ist es, zu behaupten, dass diese Welt anderer Natur als die Aussenwelt sei, eben weil sie von ihr abgetrennt ist.“ (S. 195).
‚Denken‘ ist nach Skinner keinesfalls ein Ausdruck des Geistes – es gibt ihn gar nicht –, sondern „das Verhalten, mit dem Probleme gelöst werden“. „Es ist immer die Umwelt, die das Verhalten erzeugt, mit dem Probleme gelöst werden, auch dann, wenn die Probleme Teil jener von unserer eigenen Haut umschlossenen privaten Welt sind. Nichts von alledem ist bisher hinreichend untersucht worden; doch darf die Unzulänglichkeit unserer Analyse kein Grund sein, wieder auf den wunderwirkenden Geist zurückzugreifen.“ (S. 199).
Wie schon Kant nachgewiesen hat, hat es keinen Sinn, von Moral zu reden, wenn es keine Freiheit gibt. Skinner ist konsequent genug, mit der Freiheit auch die Moral zu negieren: „Wie wir gesehen haben, ist der Mensch kein moralisches Lebewesen in dem Sinne, dass er sich durch einen besonderen Charakterzug oder durch eine besondere Tugend auszeichnet; er hat eine Art von sozialer Umwelt geschaffen, die ihn veranlasst, sich auf moralische Weise zu unterhalten“. (S. 202) Wohlverstanden: Unterhalten, nicht verhalten, d.h. mit bedeutungslosen moralischen Begriffen um sich zu schlagen.
„Die Vorstellung, die sich aus einer wissenschaftlichen Analyse ergibt, ist nicht die eines Körpers mit einer Person darin, sondern die eines Körpers, der eine Person ist in dem Sinne, dass er ein komplexes Verhaltensrepertoire entfaltet.“ (S. 204)
Die Stelle Gottes werden künftig die Gen-Techniker übernehmen, aber nicht, weil sie aus freien Stücken handeln, sondern weil sie die Umwelt dahin gebracht hat, es tun zu müssen: „Mutationen werden nicht zufällig sein, wenn Genetiker sie vorsätzlich planen, damit ein Organismus auf spezifische Auslesebedingungen erforderlicher reagiert; dann werden es die Genetiker sein, die die Rolle jenes kreativen Geistes der prä-evolutionären Theorie (gemeint ist die theologische bzw. philosophische Vorstellung, wonach sich in der Evolution ein vorausgehender göttlicher Schöpfungsgedanke verwirklicht und die Evolution somit final verläuft; AB) zu spielen scheinen. Aber den Zweck ihres Handelns, den sie erkennen lassen, wird man in ihrer Kultur, wird man in der sozialen Umwelt suchen müssen. Diese hat sie dazu gebracht, genetische Veränderungen ins Werk zu setzen, die Kontingenzen des Überlebens entsprechen.“ (S. 209 f.; ‚Kontingenzen‘ sind Umweltsituationen, die bestimmte Verhaltensweisen – hier das im Hinblick auf das Überleben der Menschheit erwünschte Verhalten – verstärken.)
3 Behavioristische Didaktik
Wie wir gesehen haben, kann nach der behavioristischen Theorie das Lernen selbst, insofern es als ‚innerer Vorgang‘ verstanden werden kann, nicht beobachtet und demzufolge auch nicht wissenschaftlich erfasst werden. Es spielt sich – wie alle subjektiv erlebten Bewusstseinsprozesse – in der ‚Black box‘ ab, die sich dem wissenschaftlichen Zugriff entzieht. Ob also Lernen stattgefunden hat, lässt sich nur aus dem Verhalten des Individuums schliessen, und zwar daraus, ob und in welcher Weise sich das Verhalten gegenüber früheren Zeitpunkten verändert hat. Lernen wird – wie bereits erwähnt – in der behavioristischen Theorie definiert als Verhaltensänderung.
Es wurde auch deutlich, dass der Behaviorismus das Verhalten als grundsätzlich reaktiv betrachtet, d.h. als Antwort auf irgendwelche Reize. Verhaltensänderungen lassen sich demgemäss durch gezielte Auswahl und Gestaltung der Reize bewusst steuern und systematisieren. Die behavioristische Didaktik betrachtet es daher als ihre Aufgabe, die Wege und Mittel zu beschreiben, mit welchen ein als wünschbar erachtetes Verhaltensrepertoire der Schüler systematisch aufgebaut werden kann.
Das behavioristische Gedankengut hat im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts einen breiten Eingang in die Didaktik der Schulen in Amerika und in den europäischen Ländern gefunden. Man versprach sich u.a., es könnte dadurch dem schulischen Lernen eine grössere Wirksamkeit (Effizienz) verliehen werden. Viele behavioristisch orientierte Schultheoretiker betrachteten die Methoden und die Stoffauswahl in den traditionellen Schulen als ‚unwissenschaftlich‘ bzw. ‚vorwissenschaftlich‘ und forderten demgegenüber die Schaffung einer wissenschaftlichen Schule, d.h. ein Bildungswesen, in welchem die Lern-Inhalte in einem wissenschaftlich begründeten Verfahren ausgewählt, gegliedert und didaktisch aufbereitet werden und in welchem dieser Stoff nach Methoden, die durch die Wissenschaft begründet und entwickelt wurden, den Schülern vermittelt wird.
Das behavioristische Lernverständnis hat demgemäss auf zwei Ebenen in unsere Schulen hineingewirkt, nämlich auf der Ebene der Inhalte und der Ebene der Methoden:
3.1 Ebene der Inhalte
Die Kritik des Behaviorismus richtete sich weniger auf die Lern-Inhalte der Schulen an sich, sondern auf die Art und Weise, wie sie in Lehrplänen und Unterrichtsvorbereitungen definiert und formuliert wurden. Diese Kritik führte in der Schweiz einerseits zu einer Umformulierung der meisten kantonalen Lehrpläne und andererseits zu einer bewusst lernzielorientierten Didaktik.
3.1.1 Grundzüge der lernzielorientierten Didaktik
Die gezielte Steuerung von Verhaltensänderungen geschieht grundsätzlich im Sinne des Dreischritts Zielformulierung – Lernprozess – Lernkontrolle:
Der Programmierer (Lehrer, Erzieher) muss sich zuerst selbst genau im Klaren sein über die beabsichtigte Verhaltensänderung. Er muss ein Lernziel setzen, das den Schüler über dessen ‚Eingangsverhalten‘ hinausführt. Dabei sind die Lernziele so zu formulieren, dass der Lehrer dann auch feststellen kann, ob Lernen in der erwünschten Weise stattgefunden hat. Bei der Lernzielformulierung sind die folgenden Grundsätze zu beachten:
Das Lernziel ist so zu formulieren, dass eine beobachtbare Verhaltensänderung anzuzeigen imstande ist, ob es erreicht ist. Falsch formuliert ist. z. B. das folgende Ziel: „Der Schüler soll die schriftliche Teilungsoperation verstehen.“ ‚Verstehen‘ kann als Angelegenheit der ‚Black box‘ nicht beobachtet werden. Die Zielformulierung lautet daher richtig: „Der Schüler soll Teilungsrechnungen schriftlich lösen können.“
Die erwünschten Verhaltensweisen müssen präzise, d.h. möglichst detailliert beschrieben werden. Oder anders ausgedrückt: Grobziele sind aufzugliedern in die erkennbaren Feinziele. „Teilungsrechnungen schriftlich lösen“ ist ein Grobziel und in dieser Formulierung für den konkreten Lernprozess zu allgemein. Eine richtige Formulierung wäre: „Der Schüler soll Teilungsrechnungen mit dreistelligen Dividenden und einstelligem Divisor schriftlich lösen können.“
Das Formulieren eines Lernziels als ein detailliert beschriebenes beobachtbares Verhalten nennt man ‚Operationalisieren‘. Das Operationalisieren von Lernzielen ist so etwas wie das A und O der lernzielorientierten Didaktik.
Der Lehrer muss sich des weiteren darüber Rechenschaft ablegen, in welchen Fällen er das Lernziel als ganz, in welchen als zum Teil und in welchen er es als nicht erfüllt betrachten will. Er muss somit eine Masseinheit für die Messung (Kontrolle) des beobachtbaren Verhaltens angeben. Unser Beispiel-Satz wäre somit zu erweitern: „Der Schüler soll von 20 Teilungsrechnungen mit dreistelligen Dividenden und einstelligem Divisor deren 15 schriftlich lösen können.“
Schliesslich gilt es zu überlegen, unter welchen Bedingungen die gestellte Aufgabe zu bewältigen ist. Möglich wäre etwa folgende Formulierung: „Der Schüler soll von 20 Teilungsrechnungen mit dreistelligen Dividenden und einstelligem Divisor in 30 Minuten deren 15 schriftlich lösen können.
Als Nächstes muss sich der Lehrer überlegen, wie die erwünschte Verhaltensänderung beim Schüler bewirkt werden kann. Er muss sich Rechenschaft darüber ablegen, welchen Reizen (Impulsen, Fragen, Materialien, Informationen) er seine Schüler aussetzen muss, damit die geplante Verhaltensänderung so sicher wie möglich eintritt. Will er ganz methodenrein vorgehen, wendet er den durch den Behaviorismus entwickelten Programmierten Unterricht an (siehe weiter unten). Hat sich der Lehrer über die geeigneten Methoden Klarheit verschafft, beginnt die eigentliche Lern- und Übungsphase.
Unmittelbar auf den Lernprozess folgt die Lernkontrolle: Das ‚Schüler-Endverhalten‘ wird mit dem formulierten Ziel verglichen. Entspricht der Vergleich der Zielsetzung, hat im behavioristischen Sinne Lernen stattgefunden. Besteht indessen kein oder kein wesentlicher Unterschied zwischen dem ‚Schüler-Eingangsverhalten‘ und dem ‚Schüler-Endverhalten‘ hat hinsichtlich der formulierten Zielsetzung eben kein oder zu wenig Lernen stattgefunden.
3.1.2 Das Curriculum
Im noch bis vor Kurzem (geschrieben 1994; AB) gültigen Lehrplan des Kantons Aargau stehen z. B. die folgenden Sätze betreffend den Leseunterricht auf der Oberstufe: „Der über das Lesebuch hinaus erweiterte Lesestoff soll wie die gesamte Welt- und Lebenskunde einerseits den Horizont des Schülers weiten und andererseits die Sicht in menschliches Innenleben öffnen und vertiefen. Proben aus den Werken grosser Dichter sollen gleichzeitig die Liebe zu guter Literatur wecken und nähren.“
Aus der Sicht des Behaviorismus erhebt sich gegenüber diesen Sätzen die Kritik,
die Ziele seien viel zu allgemein, viel zu weit gefasst
die Erfüllung der Ziele liesse sich nicht nachprüfen, weil ‚Horizont weiten‘, ‚Innenleben öffnen und vertiefen‘, ‚Liebe wecken und nähren‘ kein beobachtbares Verhalten beschrieben
dem Lehrer sei durch diese Aufzählung ‚ideologischer‘ Anliegen keine Anweisung gegeben, wie er diese hochgesteckten Ziele erreichen könne
es fehlten Angaben über Methoden und Massstäbe zur Lernkontrolle
Behavioristisch orientierte Bildungs-Theoretiker wollen daher solche Lehrpläne ersetzt wissen durch wissenschaftlich begründete und nach wissenschaftlichen Methoden errichtete Lehrpläne. Einen solchen Lehrplan bezeichnet man als ‚Curriculum‘. Ein konsequent ausgearbeitetes Curriculum enthält nach der durch die Bildungs-Wissenschafter erhobenen Forderung
die Darlegung der Kriterien, die zur getroffenen Auswahl der Lernziele führten
die Kataloge der operationalisierten Lernziele (Grobziele, allenfalls auch Feinziele)
Handlungsanweisungen an die Lehrer und Schüler zur Optimierung des Lernprozesses
Tests zur Überprüfung der Lernergebnisse (mit Bewertungs-Massstäben).
Nicht wenige Bildungs-Theoretiker versprechen sich von solchen Curricula auch eine wirksamere Einflussnahme der Wissenschaft und der führenden politischen Gremien in die einzelne Schulstube. Sie glauben, Bildung werde dadurch effektiver planbar und es liesse sich dadurch besser bewirken, dass in allen Schulstuben in den wesentlichen Belangen dasselbe geschehe. Dadurch könnten die einzelnen Klassen und die verschiedenen Schultypen optimal aufeinander abgestimmt werden (Koordination).
In der Schweiz wurde das konsequenteste Curriculum behavioristischen Zuschnitts unter der wissenschaftlichen Leitung der Universität Freiburg für die Schulen des Kantons Freiburg hergestellt. Es trat 1970/71 in Kraft, konnte sich aber nur über wenige Jahre halten. Es löste seinerzeit eine heftige Auseinandersetzung zwischen den behavioristisch orientierten Bildungs-Wissenschaftern einerseits und humanistisch ausgerichteten Pädagogen andererseits aus. Das Freiburger Curriculum war eine Auflistung von einigen Tausend relativ eng formulierter Ziele. Hier eine Auswahl:
Muttersprache, 1. Klasse
Der Schüler kann einen neuen, unbekannten Text von 10 Sätzen ohne Hilfe entziffern (Druck und Schreibschrift).
20 Wörter aus dem Sprachbereich des Schülers sollen in der richtigen Betonung gelesen werden.
Er kann 5 Gedichte wörtlich, gut betont und ohne Hilfsmittel wiedergeben.
Am Ende des Schuljahres sollen im einfachen Satz 10 Behauptungssätze in Fragesätze umgewandelt und beantwortet werden.
In 10 einfachen Sätzen, in denen das Substantiv klein geschrieben ist, muss dieses verbessert und gross geschrieben werden. Mindestens 8 müssen richtig sein.
Grammatik, 3. Klasse
Der Schüler kann die Substantive eines gelesenen Textes umschreiben.
Er kann die Verben eines gelesenen Abschnitts durch Synonyme ersetzen.
Er kann die Verben ‚gehen‘, ‚machen‘, ’sagen‘ durch je 5 andere Verben ersetzen.
Er setzt in 30 Minuten je 8 starke und schwache Verben aus dem Präsens ins Imperfekt, ohne jeden Fehler.
Geographie, 4. Schuljahr
Den Hauptgrund nennen, weshalb das Seeland einen milderen Winter hat als die übrigen Teile des Kantons.
Mindestens 8 Dörfer im Grossen Moos aufzählen, deren Bewohner sich stark mit Gemüsebau beschäftigen.
Die Endstationen der Bahnlinien nennen, welche durch die Ortschaft Kerzers führen.
Mindestens 3 Produkte nennen, die in den Fabriken im Raume von Kerzers hergestellt werden.
Angeben, ob der Murtensee tiefer bzw. weniger tief ist als der Neuenburger-, Bieler- und Schwarzsee.
Neuere Lehrpläne sind von dieser sehr mechanistischen Stoff-Auflistung wieder abgekommen und formulieren auch wieder allgemeine pädagogische Anliegen. Diese werden zumeist unter dem Begriff „Leitideen“ an den Anfang gestellt, worauf dann Kataloge von Grob-Zielen folgen. Diese Grobziele beschreiben entweder Wissens-Inhalte, Fertigkeiten oder Lernaktivitäten. Es hat so etwas wie eine Synthese zwischen traditionellen Lehrplänen und behavioristischem Curriculum stattgefunden.
3.2 Ebene der Methoden
3.2.1 Der Programmierte Unterricht
Der klassische Programmierte Unterricht (PU) ist eine Erfindung von B.F. Skinner. Der zu vermittelnde Stoff – sei dies ein Wissensgebiet oder eine Fertigkeit – wird in kleinste Lernschritte (Frames) unterteilt, deren Bewältigung dem Lernenden sofort zurückgemeldet (Feedback) wird, was er als Erfolg wertet. Dieses Erfolgserlebnis wirkt als Verstärker und bekräftigt einerseits die durch den Lernprozess bewirkte Verhaltensänderung, andererseits die Bereitschaft, den Lernprozess weiterhin aufrecht zu erhalten (Motivation). Tritt der Lernerfolg nicht ein, wird der Fehler nicht beim Schüler, sondern beim Programm gesucht. Nötigenfalls werden einzelne Frames in noch kleinere Schritte aufgelöst. Jedes Programm wird an einer grössern Anzahl Probanden ausgetestet und so lange verbessert, bis 90 % der Probanden im abschliessenden Test 90 % des Lernstoffes beherrschen.
Mowrer hat die ‚lineare‘ Programmierung Skinners erweitert durch sog. ‚verzweigte‘ Programme. Diese ermöglichen individuelle Anpassungen des Lernprozesses an die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der einzelnen Probanden. Die Aufgaben und Testfragen werden immer wieder so formuliert, dass ersichtlich wird, ob der Proband das Gelernte mit Leichtigkeit versteht, ob er damit Mühe bekundet oder allenfalls noch nichts begriffen hat. Je nachdem wird er auf den normalen Lernweg verwiesen, auf eine zusätzliche Seitenlinie gelenkt, um einige Frames zurückgeschickt oder zum Überspringen von unnötigen Frames angehalten.
Der PU wird mit Hilfe verschiedenster technischer Mittel realisiert: Bücher, mechanische Geräte (z. B. die bekannten PROFAX- und LÜK-Geräte) und Lernmaschinen. Die jüngste rasante Entwicklung auf dem Gebiet der Informatik und Elektronik (Computer) hat dem PU wieder einen neuen Auftrieb verschafft, nachdem er über viele Jahre nur mehr wenig Beachtung gefunden hatte.
Das Hauptargument, das die Befürworter des PU ins Feld führen, ist die Möglichkeit, dass jeder Schüler beim Durchlaufen eines Lernprogramms sein eigenes Lerntempo einhalten kann. Dies wird als Beitrag zur Individualisierung des Unterrichts angesehen.
3.2.2 Audio-visuelle Fremdsprach-Lehrmethode
Die audio-visuelle Methode kann als Spezialfall des PU betrachtet werden. Am Anfang stand die fundamentale Kritik an der traditionellen Sprachlehr-Methode: Diese, so wurde behauptet, führe deshalb nicht zum erwünschten und möglichen Erfolg, weil sie die Fremdsprache von der Grammatik her zu vermitteln versuche. Es gelte aber, die Sprache nicht durch Reflexion zu ‚wissen‘, sondern sie durch Angewöhnung möglichst automatisch zu sprechen. Mehr oder weniger deutlich orientierte man sich am Kleinkind, das die Sprache auch ohne alle bewusste Grammatik, lediglich durch Vor- und Nachsprechen in natürlichen Handlungszusammenhängen, erwerbe. Man suchte daher nach Wegen, auf denen grundsätzlich jegliches Erklären in der angestammten Muttersprache vermieden wurde und auch die grammatikalischen Erläuterungen weitgehend unterbleiben sollten.
Viele glaubten in den sechziger und frühen siebziger Jahren, in der behavioristischen Sprachtheorie, wonach Sprachäusserungen lediglich Reaktionen auf bestimmte äussere Reize darstellen, und in den behavioristischen Konditionierungs-Techniken den Schlüssel zum leichten, raschen und sichern Fremdsprach-Erwerb gefunden zu haben. So versuchte man, den Schülern die Sprache gemäss dem Pawlow’schen Modell der klassischen Konditionierung zu vermitteln. Das Grund-Modell des audio-visuellen Unterrichts sieht wie folgt aus:
Der Schüler wird grundsätzlich angewiesen (darauf konditioniert), alles, was eine Tonband-Stimme vorspricht, nachzusprechen. Die Tonband-Stimme ist somit der unbedingte Reiz, das Nachsprechen die unbedingte Reaktion. Nun wird die Tonbandstimme entweder mit einer kleinen Filmsequenz oder aber mit Bildern sogenannter Stehfilme gekoppelt (Reiz-Substitution). Die Bilder sind demgemäss die neutralen Reize. Nach mehrmaliger Wiederholung wird schliesslich die Tonband-Stimme weggelassen, und die Pawlow’sche Theorie lässt erwarten, dass nun das Bild allein die entsprechenden fremdsprachigen Sätze im Kinde automatisch auslöse. Die Bilder sind zu konditionierten Reizen geworden, und das dadurch ausgelöste Sprechverhalten ist zu verstehen als konditionierte Reaktionen.
Der oben beschriebene audio-visuelle Unterricht wickelt sich in der Regel immer noch im Klassenverband ab. Soll nun aber das Hauptargument der Verfechter des PU, nämlich das individuelle Lerntempo, zum Tragen kommen, muss jeder Schüler für sich allein lernen können. Diese Möglichkeit wird technisch bereitgestellt im sog. Sprachlabor. Jeder Schüler sitzt in einer eigenen Kabine, hat via Kopfhörer Kontakt mit der Tonband-Stimme und empfängt die programmierten visuellen Reize via Bildschirm. Das Sprachlabor bietet gegenüber dem einfachen audio-visuellen Lernen zwei weitere Möglichkeiten: Erstens kann der Schüler selbst auf das Tonband sprechen und so seine eigene Stimme mit derjenigen des Vorsprechers vergleichen, und zweitens hat der Lehrer die Möglichkeit, sich via Schaltpult in den Lernprozess des einzelnen Schülers einzuschalten, sei es, um lediglich mitzuhören und so die Lernaktivität des Schülers zu kontrollieren, sei es, um via Mikrophon in Kontakt mit im zu treten.
In vielen Schulen wurden solche Sprachlabors eingerichtet, doch es zeigte sich, dass sie entweder wenig gebraucht oder sehr bald von den Schülern zerstört wurden. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass bei der Beurteilung der Tauglichkeit des audio-visuellen Unterrichts nicht nur lernpsychologische und pädagogische, sondern auch wirtschaftliche Interessen auf dem Spiele stehen.
Die audio-visuelle Fremdsprach-Lehrmethode spielt auch in die Diskussion über die Frage hinein, ob in der Schweiz der Französisch-Unterricht in die Primarschule vorzuverlegen sei (heute praktisch in allen Deutschschweizer Kantonen eine beschlossene Sache). Ein wichtiges Argument der Gegner und Skeptiker ist die Feststellung, dass die Primarlehrerschaft im allgemeinen gar nicht über die Voraussetzungen verfügt, um den Französisch-Unterricht kompetent genug zu erteilen. Die Befürworter versuchen dies dann oft mit dem Hinweis auf die audio-visuellen Methoden, bei denen der Lehrer eigentlich bloss ein Tonbandgerät bedienen können müsse, zu entkräften. Tatsächlich basierten und basieren praktisch alle Schul-Versuche, die über das angesprochene Problem Unterlagen liefern sollten, auf audio-visuellen Methoden. Der Hinweis auf die Vorteile des Tonbands und der audio-visuellen Methode verfehlt indessen zumeist die erwünschte Wirkung, weil die Gegner der Vorverlegung des Französisch-Unterrichts meistens auch die audio-visuelle Methode ablehnen.
In jüngerer Zeit wird oft versucht, die Vorteile der audio-visuellen Methode mit denjenigen der traditionellen Methode zu verbinden. Es fand auf diesem Sektor etwas Ähnliches statt wie auf dem Gebiet der Lehrplan-Entwicklung: Weg von Extremen und ideologischen Positionen und hin zu Lösungen, die sich als praktikabel erweisen.
3.3 Kritische Anmerkungen
Was als ‚wissenschaftlich‘ gilt, muss deswegen noch keineswegs wahr oder richtig sein. Jede wissenschaftliche Theorie oder Aussage beruht auf Fragen, Methoden und Voraussetzungen, deren Berechtigung, Angemessenheit und Richtigkeit nicht beweisbar sind. Im Bereiche jener Wissenschaften, die sich mit dem Menschen und dem menschlichen Dasein befassen, wirken sich unterschiedliche weltanschauliche Grundlagen (Philosophien, Theologien, Menschenbilder) in ganz besonderem Masse aus und führen zu unterschiedlichen und gegensätzlichen ‚Erkenntnissen‘.
Die weltanschauliche Grundlage des Behaviorismus ist der Materialismus, der die Existenz einer eigenständigen geistigen Welt nicht anerkennt. Logischerweise bietet daher eine Didaktik, die sich einseitig auf Ergebnisse des Behaviorismus abstützt, für jemanden, der den materialistischen Standpunkt nicht teilt, sondern vielmehr überall in der Schöpfung und im menschlichen Dasein real mit der Existenz einer wirkenden geistigen Welt rechnet, manchen Ansatzpunkt zur Kritik. So ist es denn auch keineswegs ein Zufall, dass viele schulpolitische und didaktische Forderungen der Vertreter des Behaviorismus im Gegensatz stehen zu den pädagogischen Grundsätzen Pestalozzis, die auf christlich-humanistischem Denken beruhen.
Im folgenden formuliere ich meine persönliche Stellungnahme:
Wird Lernen als ‚Verhaltensänderung‘ definiert und gleichzeitig vorausgesetzt, dass die Schule dazu da sei, solche Verhaltensänderungen systematisch herbeizuführen (wovon die behavioristische Didaktik grundsätzlich ausgeht), ergibt sich daraus eine Reihe problematischer Effekte:
Das nicht Sicht- und Messbare wird entweder übersehen oder dann vernachlässigt, und alles äusserlich Feststellbare wird überbetont. Was zählt, sind messbare Leistungen. Der Schüler droht in einer so gestalteten Schule als ganzer Mensch aus dem Blick zu geraten, denn er wird vornehmlich gesehen als Wesen, das bestimmte Leistungen zu erbringen hat. Zwar ist es selbstverständlich, dass in der Schule Resultate erzielt werden sollen, die von aussen feststellbar oder allenfalls messbar sind, aber darüber hinaus hat die Schule noch eine sehr wesentliche andere Aufgabe zu erfüllen, nämlich die seelisch-geistige Ernährung des Kindes. (Vgl. hierzu Text Nr. 3 im Kapitel „Pädagogik“.) Im Rahmen dieser Aufgabe ist es z. B. sinnvoll, den Wandschmuck sorgfältig auszulesen oder das Zimmer mit Blumen zu schmücken, weil dies die Kinder in ihrem Innenleben beeinflusst, und zwar auch dann, wenn ich als Lehrer dies nicht sichtbar machen kann. Dasselbe gilt z. B. auch, wenn ich ein Märchen erzähle, ohne weiter darauf einzugehen, es also nicht nacherzählen, spielen, lesen, zeichnen lasse. Von einer Verhaltensänderung im strengen behavioristischen Sinne sehe ich nichts, das Kind hätte also nichts gelernt. Umgekehrt müsste ich beispielsweise im Religionsunterricht als behavioristisch eingestellter Lehrer zufrieden sein, wenn das Kind eine biblische Geschichte fehlerfrei wiedergeben und deren Sinn darstellen oder ein Gebet richtig hersagen kann. Aber die religiöse Erziehung muss natürlich tiefer dringen: Im Kinde soll sich ein innerer religiöser Sinn bilden, es soll sich in seinem Gemüt angesprochen und erhoben fühlen, damit in ihm der Mut zu einem allgemein guten Leben wächst. Ein solches Wachstum der Gesinnung muss sich gewiss nicht im Augenblick in einer Verhaltensänderung auswirken, die feststellbar oder gar messbar wäre, und kann es in vielen Fällen wohl auch nicht.
Man kann allerdings auch als nicht behavioristisch eingestellter Lehrer die obige Definition (Lernen = Verhaltensänderung) beibehalten, sofern man auch die ‚inneren‘ Vorgänge (Vorstellen, Ahnen, Fühlen, Gemütsbewegungen) – also das, was die Behavioristen als Vorgänge in der ‚Black box‘ bezeichnen und darum uninteressiert wegschieben – als ‚Verhalten‘ bezeichnet. Spätere Vertreter des Behaviorismus haben diesen Schritt teilweise vollzogen, indem sie wenigstens Bewusstseinsvorgänge wie Denken und Vorstellen in ihren Verhaltensbegriff aufgenommen haben.
Das ausschliessliche Interesse für das Sicht- und Messbare führt auch zu einer problematischen Überbetonung der konkreten Unterrichtsstoffe. Bildung droht zu entarten in reines Faktenwissen, und die ‚Entfaltung von Kräften und Anlagen‘ im Sinne Pestalozzis tritt in den Hintergrund. Der philosophische Materialismus des Behaviorismus schafft im didaktischen Bereich den Bildungsmaterialismus. Das Freiburger Curriculum, das die behavioristischen Prinzipien konsequent in die Praxis umzusetzen versuchte, ist dafür der beste Beleg. (Und dass es sich als untauglich erwies, belegt nicht nur die Dürftigkeit dieses als „wissenschaftlich“ ausgegebenen Ansatzes, sondern auch die Unhaltbarkeit der Annahme, Wissenschaftlichkeit sei an sich schon eine Gewähr für Wahrheit oder Tauglichkeit.)
Der Lernprozess ist im Behaviorismus einseitig zweckorientiert, d.h. er ist lediglich Mittel zum Zweck vorformulierter Ziele. Konsequenterweise ist derjenige Lernprozess der beste, der am schnellsten zum Ziel führt. Ich bin indessen davon überzeugt, dass sich wirkliche Bildung vor allem dort ereignet, wo der Blick auf Ziele und Zwecke in den Hintergrund tritt und man sich in umfassender Weise, in Freiheit und in Musse einem Lerngegenstand hingibt. Der Bildungsprozess muss in sich selbst sinnvolles Tun sein und darf nicht ausschliesslich den von aussen gesetzten Zwecken aufgeopfert werden. Der Lernertrag ist dann Folge sinnvollen Tuns.
Das Starren auf vorformulierte Ziele unterdrückt viele ungeplante und nicht planbare Zielsetzungen und Lerninteressen, die erst im Lernprozess selbst entstehen und häufig von den Schülern selbst eingebracht werden. Die Individualität des einzelnen Schülers kommt zu wenig zum Tragen. Dies ist in besonders extremer Weise im Programmierten Unterricht der Fall, wo das Denken der Schüler in exakt vorgegebene Bahnen gepresst wird und jedes Ausweichen als Störung erscheint.
Für ein Bildungsverständnis, das als einen Haupt-Zweck des Unterrichts die Vermittlung von Informationen ansieht, ist das naturgegebene Vergessen bloss eine lästige Störung, denn es bricht ständig das wieder ab, was der Lernprozess systematisch aufgebaut hat. Für ein Bildungsverständnis, dessen erstes Anliegen aber die Entfaltung von Kräften und Anlagen ist, ist das Vergessen ein natürlicher Vorgang in einer organischen Entwicklung einer geistigen Persönlichkeit.
Behavioristisches Curriculum und Programmierter bzw. Audio-visueller Unterricht beschränken die Lehr- und Methodenfreiheit des Lehrers und erschweren dadurch seinen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Freiheit ist kein Luxus, sondern die Grundlage eines menschenwürdigen Unterrichts und einer menschlichen Erziehung.
Je enger die Lernziele in vorgeschriebenen Lehrplänen und -mitteln formuliert sind, desto weniger tragen sie den vorhandenen Leistungsunterschieden der Schüler Rechnung: Schwache Schüler werden über-, leistungsstarke unterfordert.
Wichtig: Wenn ich mich gegen eine einseitig behavioristische Unterrichtspraxis wende, so rede ich nicht der Pfuscherei das Wort, die dadurch entsteht, dass der Lehrer nicht weiss, was er will. Der Lehrer muss sich seiner Ziele stets bewusst sein, aber er weiss zu unterscheiden zwischen materialen Zielen, deren Erreichen festgestellt werden kann, und allgemeinen (formalen) pädagogischen Zielsetzungen, die er in all seinem Tun stets im Auge behält und die sich auch nie in einer Lernkontrolle als ‚erreicht‘ abhaken lassen. Darum ist er auch offen für immer neue Zielsetzungen, die sich in einem lebendigen Unterricht spontan – von ihm oder von den Schülern her – ergeben. Oder mit andern Worten: Meine Kritik zielt nicht etwa auf ein „Weniger“, sondern auf ein „Mehr“ ab. Meines Erachtens greift die reine behavioristische Didaktik mit ihrem einseitigen Starren auf das Erreichen sicht- und messbarer Erfolge zu kurz. Bildung kommt nicht zustande durch eine Addition von Wissen und Fertigkeiten, sondern durch einen geistig-seelischen Prozess, bei dem alles nicht Sichtbare (z. B. Zielsetzungen, deren Erreichen sich grundsätzlich erst später erweisen kann) seinen ihm gebührenden Stellenwert hat.
4 Gestaltpsychologischer Ansatz
4.1 Die Schimpansen von Wolfgang Köhler

Vorbemerkung: Wolfgang Köhler (1887-1967) ist einer der Begründer der Gestalt-Psychologie. Da diese in einem separaten Text (Text Nr. 4 unter „Psychologie“: „Psychologie der Wahrnehmung“) eingehender behandelt wird, soll hier nur so weit darauf eingegangen werden, dass das Lern-Modell des einsichtigen Lernens klar wird und von den behavioristischen Lern-Theorien unterschieden werden kann.Wolfgang Köhler hat während des 1. Weltkriegs in französischer Kriegsgefangenschaft auf der Insel Teneriffa mit Schimpansen experimentiert und dabei die folgende Entdeckung gemacht: Ausserhalb des Käfigs lag, für den Affen mit blossem Arm unerreichbar, eine Banane. Nachdem das Tier durch alle möglichen Versuche (z. B. Rütteln an den Stäben) zu keinem Erfolg kam, setzte es sich ruhig in eine Ecke. Plötzlich – als wäre ihm „ein Licht aufgegangen“ – ging es in die andere Ecke des Käfigs, ergriff den dort liegenden Stock und angelte die Banane herein.
Der Affe hatte zweifellos etwas Neues gelernt, aber er kam darauf weder durch Versuch und Irrtum (er hat sich der richtigen Lösung nicht im Verlaufe von vielen Versuchen, die mehr oder weniger fehlschlugen, allmählich angenähert), noch durch klassische Konditionierung (seine Verhaltensweise war ja neu und konnte darum nicht mit einem neutralen Reiz gekoppelt werden) oder operante Konditionierung (niemand hat ihm das Verhalten durch graduelle Annäherung von aussen her ankonditioniert). Seiner Lernleistung lag vielmehr eine richtige Wahrnehmung der Problemsituation zu Grunde, d.h. er konnte plötzlich den Zusammenhang – noch bevor er es ausprobierte – zwischen der Entfernung der Banane vom Gitter einerseits und dem mit dem Stock verlängerten Arm andererseits „sehen“. Dies ist durchaus kein rein optisches Sehen gegenwärtig wirkender Reize, sondern ein Einsehen in eine künftige Situation, die durch das Handeln erst eintritt. Die Gestaltpsychologie nennt eine Situation, die in sich ein geschlossenes Ganzes bildet, eine Gestalt. Der Stock, das Gitter, die Banane, der Arm – dies alles sind, für sich genommen, Gestalten (sie bilden in sich ein geschlossenes Ganzes), aber solange einfach nur diese Gestalten wahrgenommen werden, ergibt sich keine Lösung des Problems. Der Lösung, die der Affe plötzlich entdeckte, liegt vielmehr die Fähigkeit zu Grunde, die gesamte Situation (Armeslänge plus Stocklänge im Vergleich mit dem Abstand vom Gitter zur Banane) als eine Gestalt wahrzunehmen. Solange er diese Gestalt nicht überblickt, nützt alles Probieren nichts, denn seine Triebe ziehen ihn stets in Richtung Banane: die richtige Lösung hingegen erfordert, dass er sich zuerst von der Banane entfernt. Der Affe hat also durch Einsicht gelernt, er hatte eine Gestalt gebildet.
Drei Merkmale sind typisch für das Lernen durch Einsicht:
- ein „inneres Trial-and-error-Verhalten“, was sich in einem Innehalten der Bewegungen (Besinnungspause) manifestiert,
- das plötzliche Auftauchen der richtigen Lösung („Aha-Erlebnis“) und
- der Umweg, der zur Lösung führt.
In andern Experimenten haben Köhlers Schimpansen eine Banane von der Decke des Käfigs geholt, indem sie Kisten stapelten, wobei die Stapelung der Kisten an sich allerdings nicht durch Einsicht, sondern durch Versuch und Irrtum erlernt wurde. Der intelligenteste Affe brachte es sogar soweit, eine auch mit einem Stock nicht erreichbare Banane hereinzuangeln, nachdem ihm – mehr durch Zufall – das Zusammenstecken zweier Stöcke gelungen war.
4.2 Einsichtiges Lernen beim Menschen
Es ist sehr erstaunlich, dass Tiere so lernen können. Für den Menschen jedoch ist dies das Normale. Zwischen dem einsichtigen Lernen eines Tieres und eines Menschen besteht allerdings ein fundamentaler Unterschied: Das Tier kommt ausschliesslich über die richtige Sinnes-Wahrnehmung eines Problemfeldes zur Einsicht, wogegen dem Menschen Einsichten sprachlich vermittelt werden können. Das hängt damit zusammen, dass die sprachliche Kommunikation grundsätzlich auf dem gemeinsamen Begriffsinstrumentarium beruht und dass die Begriffe an sich schon stets eine Einsicht darstellen. Da nun neue Begriffe beim Menschen nicht ausschliesslich über die direkte Sinnes-Erfahrung (Anschauung), sondern mit zunehmendem Alter des Individuums immer stärker auch durch begriffs-sprachliche Vermittlung aufgebaut werden, bedeutet dies eben, dass Einsichten sprachlich weitergegeben werden können.
Die zentrale Bedeutung der nur dem Menschen gegebenen Sprache für das Zustandekommen von Einsicht belegt, dass das einsichtige Lernen das dem Menschen angemessenste ist. Das Lernen durch Einsicht steht daher in der Schule im Zentrum. Die vorstehenden Gedankengänge zeigen auch, dass Pestalozzis Forderung nach einer intensiven Verbindung von Anschauung (Sinnes-Wahrnehmung) und Sprache (begriffliche Klärung von Sachverhalten zwecks Aufbau von Einsichten) mit neueren lernpsychologischen Überlegungen übereinstimmen.
4.3 Das Verhältnis zwischen Lernen durch Versuch und Irrtum, einsichtigem Lernen und Übungs-Erfordernis
Weil der Mensch bei all seinem Tun Einsicht haben und sie auch meist gar nicht vermeiden kann (er begleitet eben alles durch sein begriffliches Denken), kommt bei ihm reines Lernen durch Versuch und Irrtum (oder auch reine Konditionierung) eher selten vor. Zumeist sind diese Lernvorgänge durch Einsicht begleitet, was z. B. die sog. „Trial-and-Error-Phase“, aber auch die Übungsphase wesentlich verkürzt.
Zwischen Lernen durch Versuch und Irrtum und Lernen durch Einsicht besteht ein einigermassen gesetzmässiger Zusammenhang. Diese beiden Lern-Arten verhalten sich zueinander komplementär, d.h.: Je mehr Einsicht beteiligt ist, desto weniger muss ich probieren. Dieser Zusammenhang kommt in einem alten Sprichwort zum Ausdruck: „Probieren geht übers Studieren.“ Ob das Trial-and-Error-Lernen der Einsicht allgemein vorzuziehen sei, darf freilich bezweifelt werden. Sprichwörter sagen oft nur die halbe Wahrheit.
Ein ähnlicher Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Lern-Arten und dem Übungserfordernis. Je stärker das Versuch-und-Irrtum-Verhalten im Vordergrund steht, desto grösser ist die Bedeutung des Übens im Sinne der Wiederholung – und umgekehrt. So muss z. B. ein Kind seine Klötze immer wieder von neuem aufeinander stellen, bis sich das Verhalten, das zum Erfolg führt, verfestigt. Stellt man indessen einem Erwachsenen die Aufgabe, zwei in ihrer Massenstruktur komplizierte Körper aufeinander zu stellen, so kann er nicht fehlgehen, wenn ihm die Lage des Schwerpunkts des aufzulegenden Körpers bekannt ist. Er hat eben Einsicht in die statischen Gesetze und wird daher dank dieser Einsicht die Aufgabe auf Anhieb richtig lösen.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, weshalb wir denn z. B. im Rechnen so oft üben, wenn doch das Rechnenkönnen grundsätzlich auf einsichtigem Lernen beruht. Eine exakte Analyse des Sachverhalts zeigt, dass wir eben nicht die einzelne Einsicht an sich in der Übung wiederholen, sondern durch den wiederholten Vollzug verwandter Einsichten das Einsichten-haben-Können ganz allgemein üben. Oder anders ausgedrückt: Geübt wird nicht der einzelne Denkakt, sondern der Denkprozess, das Denken selbst.

